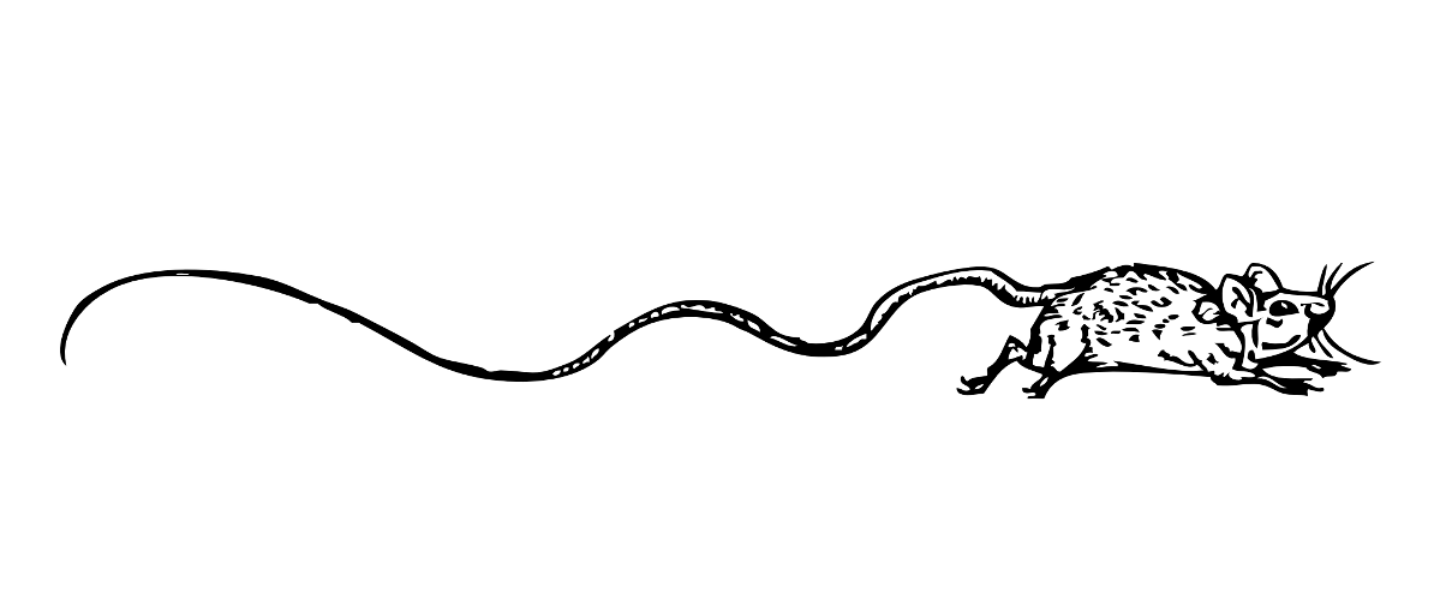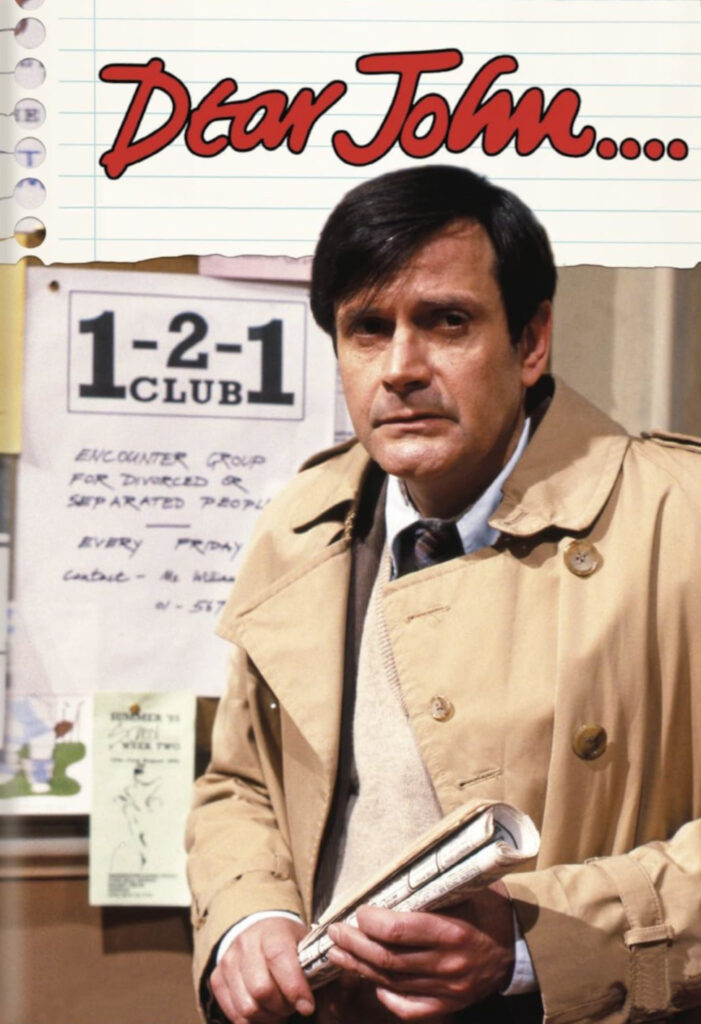
Darum geht’s: Nachdem der Lehrer John Lacey (Ralph Bates) überraschend von seiner Frau verlassen wurde, treibt ihn die Einsamkeit zum 1-2-1-Club, einer Selbsthilfegruppe für Geschiedene und Getrennte. Dort trifft er auf die versammelten Neurosen eines Großbritanniens der ausgehenden 1980er Jahre und muss schnell erkennen, dass er sich wunderbar in diese Gruppe einfügt.
Achtung: Schwere Spoiler!
A: Ich finde den Titel interessant, denn dieser „Dear John“- Brief, der in der Eröffnungssequenz immer gelesen wird, ist ja eigentlich eine Anspielung auf etwas aus dem Ersten Weltkrieg, also auf die angelsächsischen Soldaten, die Briefe von ihren Freundinnen bekommen, dass die jemand anders kennengelernt haben oder nicht mehr auf sie warten können. Da „John“ so ein Allerweltsname ist, sind die bekannt geworden als „Dear John Letters“. Und hier hat man einen Mann in seinen 40ern, der schon total etabliert ist, und der kriegt dann so einen Brief und wird aus der Bahn geworfen.
J: Heute geht die Tendenz ja eher dahin, in Serien immer jüngere Leute zu haben. „Young Adult“ ist sehr gefragt, obwohl die Leute in Serien wie Sex Education (Nunn, UK 2019–2023) auch nicht wirklich junge Erwachsene sind, sondern eigentlich noch Teenager. Und hier hat man etwas, was ursprünglich jüngere Leute betraf, auf ein höheres Lebensalter übertragen. Die Serie spricht schon bewusst Zuschauer an, die in der Mitte des Lebens stehen.
A: Und ich glaube, eine Trennung ist auch anders in jungen Jahren als in der Mitte des Lebens. Klar, Enttäuschung und Schmerz gehören immer dazu, aber in der Mitte des Lebens hat man sich schon total eingerichtet.
J: Und daraus zieht die Serie auch ihren Humor, dass man im Grunde so eine Gruppe völlig “unvermittelbarer” Midlife-Leute hat.
A: Heute würde man vielleicht nicht davon ausgehen, dass sie nicht vermittelbar sind. Aber in den 1980ern war es noch ein relativ frisches Phänomen, dass so viele Ehen geschieden werden. Und das ist das erste Mal, dass es in größerem Stil Vermittleragenturen und Selbsthilfegruppen für die geschiedenen Menschen in der Mitte der Gesellschaft gibt.
J: Wobei hier aber auch Klasse und Stand eine Rolle spielen. Die meisten Mitglieder des „1-2-1-Club“ leben in ziemlich prekären Verhältnissen. Ungewöhnlich ist ja, dass es hier ein Mann ist, der durch die Scheidung so sehr in die Armut absteigt. Das betrifft ja meist eher Frauen, vor allem Alleinerziehende. Aber hier ist es umgekehrt. Wendy behält alles und ist schnell wieder liiert. Und er muss in einem schäbigen Zimmer wohnen. Aber alle in der Selbsthilfegruppe versuchen zumindest den Anschein zu wahren, als würden sie weiter zur Mittelschicht gehören.
J: Ein bisschen etwas vom Kirk St. Moritz haben die alle. John erzählt auch immer seinem Arbeitskollegen, was für ein tolles Leben er hat, wo er alles hinfahren und was er alles unternehmen würde. In Wahrheit sitzt er die meiste Zeit einsam in seinem kleinen Zimmer und kann sich nicht mal einen Besuch im Restaurant leisten.
A: John repräsentiert damit aber auch ein Klischee, das schon ziemlich fest etabliert war, und zwar, dass der Mann so viele Alimente zahlen muss, dass er sich kaum noch irgendwas leisten kann und die Frau in Saus und Braus lebt. Das ist so ein misogyner Vorwurf, so eine Art Kellerwitz, damals wie heute. Das ist ja auch ein beliebtes Stammtisch-Thema, dass die Frauen einen quasi ausnehmen, wenn die Beziehung in die Brüche geht.
J: Mag sein, aber in der Realität ist das meistens andersrum.
A: Klar, aber hier wird es schon wie eine reale Gefahr dargestellt, dass es so arg kommt. Er steigt ja wirklich komplett ab. Das hat auch sehr viel mit England zu tun haben, mit der sozialen Situation damals. Die Serie hat auch etwas von diesen britischen Sozialdramen, also von diesem sozialen Realismus, wo es um die Ärmsten der Armen geht. Da gibt es ja so eine ganze Geschichte von BBC-Dokumentationen aus den 1960ern, den Ken Loach-Filmen, und so weiter. Und das klingt hier in dieser völlig maroden Wohnung an.
J: Und dann nimmt er auch nur eine einzige Tasche mit. Klo auf dem Gang. Jeden Sonntag muss er mit seinem Sohn in den Zoo, weil in seinem Zimmer gar kein Platz für beide ist. Aber auch Ralph lebt in so einer ganz heruntergekommenen Wohnung, die er sich mit seiner Mutter teilt. Und dann ist da Louise, die die Selbsthilfegruppe leitet. Die ist, glaube ich, nicht von diesen Problemen betroffen, aber in ihr steckt sehr viel Sozialvoyeurismus. Sie nimmt die ganzen Reality-Shows so ein bisschen vorweg, da sie die Selbsthilfegruppe weniger leitet, um zu helfen, sondern mehr, um die Leute auszuquetschen.
A: Irgendwie passt das aber sehr gut zu diesem Thema, dass im Grunde die Frauen, gerade wenn sie geschieden sind, eher sozial aufsteigen und die Männer absteigen. Louise ist gut situiert, Kate ebenfalls, sie kann sogar spontan ihren Job aufgeben und nach Griechenland reisen. Und Mrs. Arnold ist vermutlich auch eher so gehobene Mittelklasse. Und Sylvia war in ihrer Ehe richtig wohlhabend und hat sich dann ja von ihrem Partner – also eigentlich Partnerin, da George sich ja als eine trans Frau outet – im Guten getrennt.
J: So gesehen hat das dann wirklich eine ziemlich misogyne Richtung. Man könnte an heutige Männerrechtsgruppen denken.
A: Ja, wobei ich sagen würde, dass Wendy die einzige Frau ist, die tatsächlich ein bisschen negativ konnotiert ist.
J: Echt? Ich finde Louise ist auch sehr negativ gezeichnet, da das Voyeuristische so stark rausgestellt wird.
A: Stimmt, andererseits handeln ja alle Figuren immer nach egoistischen Impulsen. Bei den meisten wird das von der Serie aber nicht so stark verurteilt. Bei Wendy hingegen hatte ich am ehesten das Gefühl, dass dieses Wechselhafte, dieses Opportunistische in etwas negativerem Licht erscheint als bei anderen Figuren.
J: Wer aber so gar nicht in dieses Schema passt, ist Johns Nachbarin, die Frau Lemenski, wobei sie sich auch nicht getrennt hat, sondern ihr Mann als Widerstandskämpfer von Deutschen ermordet wurde.
A: Und sie ist Migrantin und gehört zu einer anderen Altersgruppe. Sie ist ja bestimmt schon in ihren 60ern. Im Grunde spricht sie als Einzige immer die Wahrheit aus, wenn sie zu John sagt: „You mad person“. John verhält sich da im Haus wirklich völlig verrückt. Man sagt ja generell, dass Leute in der Midlife-Crisis ein bisschen durchdrehen. Aber hier in der Serie ist das mit so einem düsteren Ballast verbunden, der so nach oben gespült wird. Das ist nicht charmant oder ein bisschen peinlich, sondern teilweise richtig bitter. Aber es ist interessant, dass sie und John dann am Ende zusammen beim Weihnachtsdinner landen.
J: Vielleicht steht das für eine gewisse Bereitschaft, endlich der Wahrheit ins Auge zu sehen. Vielleicht ist das ein erster Schritt hin zur Besserung, der aber gerade nicht durch diesen 1-2-1-Club entsteht, sondern dadurch, dass er sich an jemanden hält, der schon eine andere Reife hat und der offen ist, wirklich Gefühle vermittelt. In der Selbsthilfegruppe sind die Leute ja mehr eine Art Notgemeinschaft, die zusammen findet, weil es in Johns Alter schwierig ist, neue Freundschaften zu schließen. Doch echte Freundschaften entstehen da nicht.
A: Die Serie zeigt diese Isolation, in die man gerät, wenn man schon älter ist und plötzlich die normalen sozialen Verbindungen abkappen. Alle Freunde, die man hatte, waren eigentlich nur auf diese Ehe bezogen. John bekommt ja keine Einladungen mehr von den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet und die mal seine Freunde waren.
J: Aber er belügt sie auch die ganze Zeit. Er erzählt immer, was für aufregende Pläne er für seine Wochenenden hat.
A: Da in der Schule scheint so ein Hahnenkampf zu sein, wo jeder einfach immer zeigen soll, wer der tollste Macker ist. Im Grunde nutzen die sich ja einfach gegenseitig aus.
J: Das Komische ist, dass auch Wendy sehr einsam zu sein scheint. Sie trennt sich von John und liiert sich mit seinem ehemaligen Freund, aber diese Beziehung scheint auch nicht zu funktionieren. Am Ende sitzt sie Weihnachten alleine da.
A: Da ist so eine große Ausweglosigkeit. Egal, was man versucht, es gibt nicht wirklich ein Entkommen aus der Einsamkeit. Das zeigt sich sehr klar an der Doppelfigur Eric Morris / Kirk St. Moritz.
J: Eric Morris könnte man als so eine Parodie von jemanden lesen, der psychologische Tipps ernst nimmt, also der in Wirklichkeit ein introvertierter Mensch ist, dann aber auf Leute hört, die sagen: „Sei extrovertierter! Sag doch einfach irgendwas, wenn du mit anderen Leuten zusammentriffst!“ Und er setzt das dann extrem stark um, und ist dabei genauso einsam wie zuvor.
A: Und seine echte Persönlichkeit verkümmert dabei Zuhause bei seiner Mutter. Also allein diese zwei Folgen, wo John ihn bittet, doch einfach als er selbst, also als Eric Morris, zur Selbsthilfegruppe zu kommen. Das hat ja total was von einem Coming-Out: „Du musst allen zeigen, wer du wirklich bist.“
J: Aber bei beiden Malen schreckt er davor zurück und macht es dann doch nicht.
A: Wenn man das so liest, muss man sagen, dass Kirk der Charakter ist, der am stärksten in der Serie scheitert. Weil am Ende seine fingierte Person sogar real wird. Plötzlich kann er Kampfsport und vermöbelt die Hells Angels, die in diese Bar reingehen, um Unruhe zu stiften. Wie bei Superman geht er ins Bad, kommt als Kirk wieder raus und rettet alle. Doch dadurch hat er gar keine Möglichkeit mehr, sich von dieser Person zu verabschieden. Er hat nie mehr die Chance, er selbst zu werden.
J: Aber die Idee, er käme mit Kate zusammen, wenn er einfach bloß er selbst ist, ist vielleicht auch nicht mehr als eine Illusion. Zumindest kommt Kate am Ende ja mit jemandem zusammen, der weder Kirk St. Moritz noch Eric Morris ähnelt.
A: Es ist einfach überhaupt gar keiner da in dieser Selbsthilfegruppe, wo man denkt: „Okay, zu dem kann man wirklich eine Beziehung aufbauen, der ist offen und genuin an dem anderen interessiert.“ Wenn du ein sozialer Außenseiter bist, weil du irgendwie „sozial dysfunktional“ bist oder wie man das beschreiben würde, dann kann man dem nicht entkommen. Auch nicht mit irgendwelchen Selbsthilfe-Tipps oder tausend Sachen, die man probieren kann, um Leute kennenzulernen. Das Ganze ist also auch ein bisschen eine „Anti-Positiv-Denken“-Geschichte.
J: Besonders entkommt man der Einsamkeit nicht einfach durch das, was man oft in so „Feel-Good“-Filmen sieht, also dass sich zwei oder mehr soziale Außenseiter zusammentun und die engsten Freunde werden. Hier funktioniert das gar nicht. Dieser „1-2-1 Club“ ist ja total das Gegenteil von dem, was man heute einen „Safe-Space“ nennen würde. Also egal, was da jemand für ein Problem hat – ob unfruchtbare Ehe, Asexualtität, Asperger-Syndrom, dem Hadern mit der eigenen Gender-Rolle aufgrund des Outings der Partnerin – überall wird erstmal draufgehauen. Und das soll laut Louise helfen und so ein freier Fluss von Gedanken sein. Letzten Endes sind alle aber immer total fertig.
A: Louise provoziert das ja einfach nur, um sich daran zu ergötzen. Das ist schon so ein „Anti-Feel-Good“-Ding. Es gibt keine Minderheit, keine Beeinträchtigung, niemanden, der von der Norm abweicht, der in diesem Rahmen irgendwie sicher wäre. Allein deswegen wäre das eine Serie, die du heute überhaupt nicht mehr in der Form machen könntest.
J: Jedenfalls nicht, ohne das ganz auszudiskutieren oder unmissverständlich klar zu machen, dass die Homophobie und andere reaktionäre Ressentiments das eigentliche Problem sind.
A: Hier ist es eher so, dass es so eine Art Bonding darüber gibt, dass sich alle konstant gegenseitig in die Pfanne hauen. Aber es wirkt halt schon masochistisch, wie die sich da immer zusammenrotten bei diesen furchtbaren Empfängen und Diskos.
J: Und es wirkt auch nicht wie etwas, das jemanden weiterbringt. Innerhalb dieser Gruppe etabliert sich für keinen irgendeine Lösung.
A: Das ist halt eine Selbsthilfegruppe, wo überhaupt kein therapeutisches Konzept dahintersteckt, wo nur Leute mit ähnlichen Problemen gesammelt werden. Das gibt es öfter. Die einzige Selbsthilfegruppe, wo ich mal war, war genauso. Das war furchtbar. Da waren Leute, die einfach nur die ganze Zeit über sich selbst reden wollten und das extrem nach außen getragen haben.
J: Ich würde schon zweifeln, ob die Leute im „1-2-1“-Club wirklich dasselbe Problem haben. Wäre nicht jeder von Ihnen besser in einer Selbsthilfegruppe aufgehoben, die spezifischer auf das jeweilige Problem gemünzt ist, das hinter dem Scheitern ihrer Beziehung steht? Heute gäbe es Gruppen für Menschen, die unter ungewollter Kinderlosigkeit leiden, oder Empowerment-Gruppen für asexuelle Menschen.
A: Das ist die Frage, ob die alle in dieser Gruppe gelandet sind, weil es diese Angebote nicht gibt. Das Selbsthilfe-System war damals nicht so ausdifferenziert. Deswegen gibt es vielleicht in der ersten Folge diese Verwechslung, wo John aus Versehen bei den Anonymen Alkoholikern landet und einige von den neuen Mitgliedern der Anonymen Alkoholikern im „1-2-1“-Club. Und so gegen Ende der Serie hat man das Gefühl, dass einige wirklich Alkoholiker werden.
J: Dennoch ist auch der Alkoholkonsum bei vielen im „1-2-1“-Club eher ein Symptom wie das eigentliche Problem. Ein richtiger Therapeut würde wahrscheinlich sagen, die gescheiterte Beziehung ist auch nicht das Hauptproblem, sondern ist mehr eine Folge von einem anderen Grundproblem.
A: Ja, das ist halt keine Selbsthilfegruppe, wo konstruktiv irgendwas rauskommt. Was die alle gemeinsam haben, ist einfach, dass sie einsam sind und es nicht hinbekommen, neue Beziehungen zu etablieren. Dahingehend haben die schon ein ähnliches Problem. Aber die Gründe sind sehr unterschiedlich.
J: Aber das Verständnis füreinander ist einfach gar nicht da. Es würde ja vielleicht trotzdem funktionieren, wenn mehr Willen vorhanden wäre, sich auf den anderen einzulassen.
A: In einer besseren Selbsthilfegruppe könnte man moderiert diese Sachen teilen, um die Gefühle besser verarbeiten zu können, die das produziert, und sich dann für seine Probleme noch andere, spezifische Hilfe suchen. Auffällig ist, dass so getan wird, als wären alle gleich in dieser Gruppe, als würden die sich alle an diesem Modell „Durchschnittsmensch“ messen lassen, und der jeweils andere ist nur einfach nicht erfolgreich, eine Beziehung aufzubauen, weil er diesen oder jenen Tick hat oder sich irgendwie falsch verhält. Dabei geht es um Eigenschaften, die so tief drin sind in den Leuten, dass die sich überhaupt nicht so rauslösen lassen.
J: Und es ist auch die Frage, ob man dann wirklich glücklicher wäre. Es ist schon eine Serie, die sehr auf diese Normen abhebt. Doch aus heutiger Sicht würde man vielleicht eher sagen, dass z.B. eine asexuelle Person nicht dadurch glücklich wird, dass sie sich irgendwie doch diesem sexuell aktiven Ideal anpasst.
A: Wobei man die Serie auch genau andersrum lesen könnte: Im Grunde ist John eigentlich der totale Durchschnittsmann, sowohl von seinem Namen als auch von seinem Beruf her. Durchschnittlich attraktiv und so. Er ist dieser totale John Doe im Grunde. Aber er handelt trotzdem genauso „sozial dysfunktional“ wie jemand, der auf dem Asperger-Spektrum ist oder wie jemand, der extrem zwischen Introvertiertheit und Extrovertiertheit schwankt.
J: Eigentlich gibt es gar keinen in der Serie, bei dem Beziehungen normal funktionieren.
A: Ja, im Grunde geht es einfach immer um diese Enttäuschung des Erwachsenenlebens, die Enttäuschung der sehr hohen Erwartung, die die Charaktere aus der Kindheit mitnehmen. Viele von denen sind ja fast wie Kinder, vor allem Ralph und Kirk werden wie große Kinder dargestellt, die immer noch kindliche Hoffnung und Erwartung und auch Begeisterung haben. Ein Schlüsselmoment ist hier die „TARDIS in Reverse“.
J: Wo kommt das noch nochmal vor?
A: Als Kirk das erste Mal in Johns Wohnung ist. Da sagt er doch: „Das sieht von außen viel größer aus. Es ist wie eine ‘TARDIS in Reverse’“.
J: Das zeigt sehr gut diese Grundstimmung der Enttäuschung. John stellt sein Leben so groß dar, in Wahrheit ist es auf ein kleines Zimmer geschrumpft.
A: Und das lässt sich auf die Charaktere selbst übertragen. Doctor Who (UK 1963- ) ist ja sehr optimistisch, und es ist dort immer so, dass mehr in den Menschen drin ist, als man auf den ersten Blick sieht. Die Leute haben viel Potential.
J: Und hier: Diese Charaktere seht ihr von außen. Das sieht erstmal sehr glänzend und vielfältig aus. Aber eigentlich sind die sich am Ende sehr ähnlich.
A: Genau, heute hätte man diesen Essentialismus und würde sagen: „Jeder ist anders und muss seinen eigenen Weg finden, mit eigenem Selbsthilfebuch.“ Aber in Dear John ist das tiefer liegende Problem – vielleicht durch Epigenetik, Kriegstraumata und so – bei allen diese Unfähigkeit, sich tiefergehend zu verbinden.
J: Da ist nichts, was durch so eine Selbsthilfegruppe herausgekitzelt werden kann. Das ist nicht diese Geschichte: „Oh, da kommt der ganz schüchterne Typ in eine Selbsthilfegruppe und die locken dann seine verborgenen Talente raus und er wird ein toller Lehrer oder ein super Unterhalter.“ Hier gibt es einfach nichts unter der Oberfläche, was hervorgeholt werden könnte.
A: Im schlimmsten Fall ist sogar noch weniger an ihm dran als man dachte: „Less than meets the eye“.