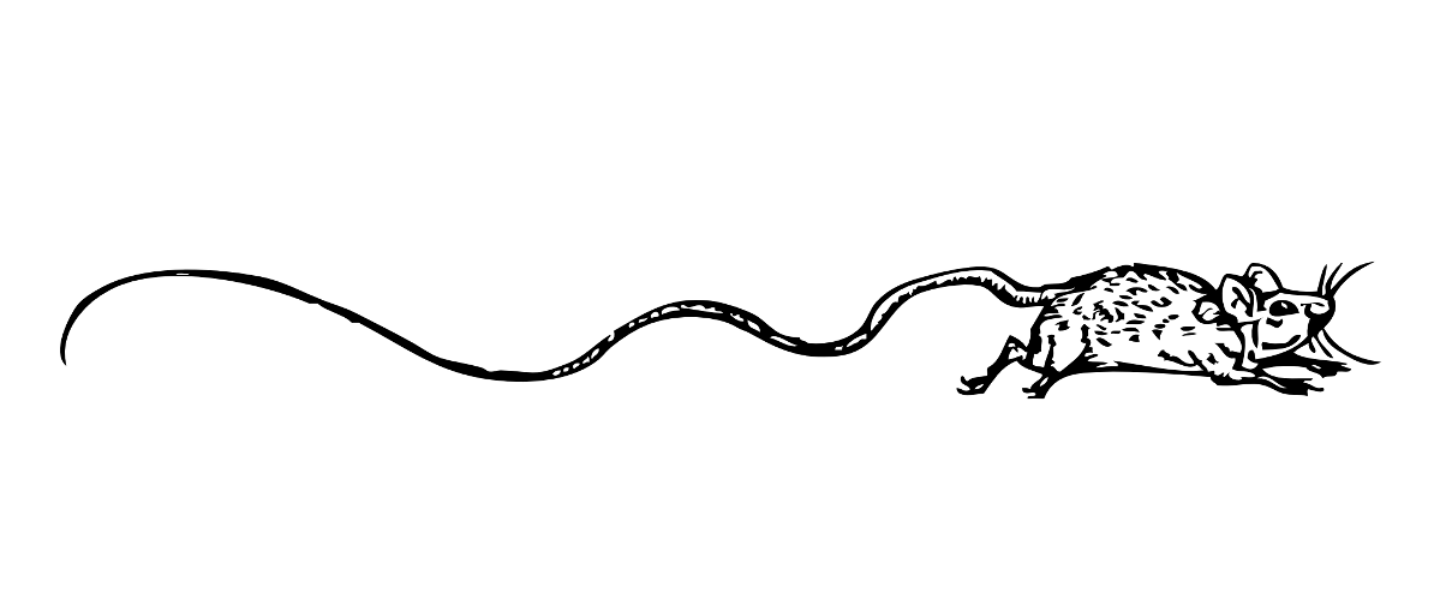Achtung: Schwere Spoiler!
Darum geht’s: Der lakonische Kommissar Carlos untersucht einen Todesfall in seinem verschlafenen Fischerort. In Verdacht geraten zwei Schwestern, die alleine auf einer Insel leben. Alida, die sich als alte Flamme von Carlos entpuppt, betreibt dort ein Bordell, während die stumme und schwangere María die Nähe zum Strand und zum Meer sucht. Als Andy, der Sohn des Syndikatsoberhauptes Raul, versucht, María zu vergewaltigen, erschießt ihn Alida. Dies ruft Andys Verlobte Silvia auf den Plan.
Warnung: Dieser Text beschäftigt sich eingehend mit einem fiktionalen Selbstmord.
A: Der Sommerurlaub kann beginnen! Ich habe mich lange nicht so schön entkrampft und leichtfüßig gefühlt.
J: Ja, alles an Bahía blanca bleibt die ganze Zeit über entspannt. Selbst der Kommissar, der ermitteln soll, scheint es nicht eilig zu haben oder irgendeine Dringlichkeit zu sehen. Auch die anderen Charaktere nicht, obwohl ihr ganzes Leben auf so eine komplette Leere zuläuft. Aber sie scheinen das nicht zu sehen oder es scheint sie nicht zu schrecken. Keiner ist in großer Hektik. Der Sommer plätschert so dahin.
A: Genau, das plätschert! Irgendwie ist für diese Figuren alles schon passiert, obwohl da, wie bereits von Alida (Eva León) im Prolog angedeutet wird, noch etwas Unheilvolles in ihrer Zukunft lauert. Trotzdem haben diese Menschen schon ein ganzes Leben gelebt mit Ups und Downs und Problemen und Tragödien. Und man erfährt nur Bruchstücke daraus. Das ist ganz anders erzählt als heute, wo oft penibel auserklärt wird, wie oder warum die Figuren so geworden sind, wie sie sind. Das ist hier alles gar nicht wichtig. Man trifft sie eben zu einer gewissen Zeit an der titelgebenden weißen Bucht, und guckt, wie es zu Ende geht.
J: Interessant ist auch das Meer in dieser Hinsicht. Das wird ja immer eigentlich nur als eine helle, glatte Fläche gefilmt, aber nie als etwas inszeniert, was Tiefe hat und auch bedrohlich ist, anders als in den klassischen griechischen Sagen, auf die angespielt wird, wo die Unergründlichkeit der Tiefen des Meeres zentral ist. Das ist besonders auffällig, da auf der Handlungsebene eine Figur in dem Meer versinkt: María (Lina Romay) stürzt sich in die Schlucht, ertrinkt und wird nie gefunden. Doch auf der Bildebene bleibt das Meer eine glatte, helle, eigentlich recht einladende Oberfläche. Und ein bisschen ist das auch bei den Figuren so. Es wird nur ihre Oberfläche eingefangen. Man erahnt vielleicht, dass da doch irgendwo mehr hinter sein muss, aber die Kamera hat gar nicht die Ambition, das einzufangen.
A: Da sollen keine psychologischen Untiefen ergründet werden, sondern charakterliche Tendenzen oder auch Sehnsüchte. Schon starke Gefühle, aber keine, die an irgendetwas Untergründiges anschließen. Man weiß nicht genau, wo diese Traumata herkommen, die einige der Figuren haben. Man sieht, dass sie da sind, allein schon durch diese Unfähigkeit, miteinander zu reden. Ganz zentral ist das in der Schwesternbeziehung: Alida kann mit María überhaupt nicht kommunizieren oder sie lesen. Sie versteht nicht, wer sie eigentlich ist oder was sie antreibt. Aber es gibt auch kein Bedürfnis, dem weiter auf den Grund zu gehen, sondern eher schon, der Sehnsucht der Figuren zu folgen, sich selbst in dieser Fläche des Wassers auszulöschen oder aufzulösen, also gar nicht so sehr ins Wasser reinzugehen, um etwas Verborgenes hervorzuholen, sondern sich vielmehr im Horizont zu verstreuen.
J: Genau, die Beziehung zwischen den Schwestern versucht der Film gar nicht zu verstehen, obwohl sie extrem rätselhaft ist. Mir war nie klar, ob Alida eigentlich María beschützt oder selbst Teil eines Missbrauchskomplexes ist. Klar, auf der Oberfläche ist sie immer die Retterin, die dann in letzter Sekunde zu Hilfe kommt, wenn erst Pocho und dann Andy (José Llamas) versuchen, María zu vergewaltigen. Aber man merkt ja auch, dass in dieser Beziehung mit den Schwestern etwas nicht stimmt. Vor allem in der ersten Szene, wo María eingeführt wird und sie am Strand in dieser Holzumrandung ist, die wahrscheinlich nur ein Sonnenschutz sein soll, aber es wirkt wie ein Käfig, da sie gegen die Wände anzurennen scheint. Und dann gibt es diese Szene, wo Alida sie ins Bett bringt, mit ganz vielen Puppen, aber María ist ja eine erwachsene Frau.
A: Sie entzieht sich jeglicher Kategorisierung und wird von verschiedenen Menschen komplett unterschiedlich gelesen. Carlos (Antonio Mayans), der Inspektor, fängt ja auch etwas mit ihr an, obwohl er schon eine Beziehung zu Alida hat. Da gibt es auch eine Vergangenheit, die gar nicht näher erklärt wird, aber man merkt, dass eine alte Vertrautheit zurückkehrt. Als er mit María zusammenkommt, verteidigt er das vor Alida damit, dass sie doch ganz offensichtlich eine Frau sei, und Alida antwortet: “Nein, sie ist doch ein Kind”. Die Kommunikation zwischen María und dem Publikum klappt viel besser. Man hat das Gefühl zu verstehen, was sie möchte und warum sie bestimmte Verhaltensweisen nachahmt. Aber die anderen Charaktere können das gar nicht nachvollziehen.
J: Als Zuschauende fühlt man sich mit María verbunden, denn sie hat ja schon eine ziemlich intensive Körpersprache und ein sehr sprechendes Gesicht. Man gewinnt schon den Eindruck, dass sie sich darüber recht gut vermitteln kann, nur ausgerechnet ihre Schwester und die anderen Leute in ihrem Umfeld verstehen das gar nicht. Es gibt ja auch diese eine Szene, wo Carlos und Alida sich das erste Mal wiedersehen und da kommunizieren sie ja komischerweise auch viel non-verbal, nämlich über das Lachen. Oft gucken sie sich einfach an und lachen miteinander. Doch als María das mitmachen und nachahmen möchte, wird das von beiden überhaupt nicht als Kontaktversuch verstanden. Alida wird gleich total ernst.
A: Es gibt ja auch diese Szene am Anfang, wo María wirklich eine irre Lache aufsetzt, was den anderen fast schon den Spiegel vorhält, und eben zeigt, dass dieses Lachen im Grunde ein Schutzmechanismus ist oder auch eine Hilflosigkeit zeigt, weil man nicht anders fähig ist, Kontakt miteinander herzustellen. Und das scheint María zu erkennen und wiederzugeben in so einem Moment. Und dass sie versucht, das zu imitieren, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie einfach dazu gezwungen ist, auf dieser Insel irgendwie zu leben, was ihr viel schwerer fällt als den anderen, weil die Sehnsucht danach, sich in der Weite aufzulösen, bei ihr viel stärker ist. Wohingegen die Schwester sich ja nachher darauf auch zurückzieht, auf der Insel zu bleiben, in der totalen Isolation und Einsamkeit und eben nicht mehr Richtung Meer zu streben.
J: Alida ist ja auch die unbeweglichste Figur in dem Ganzen. Alle anderen bewegen sich, und sie bleibt immer auf der Insel, obwohl da nichts mehr ist am Ende, nur noch Leere. Diese totale Isolation ist irgendwo auch etwas Selbstgewähltes. Man hat das Gefühl, die Figuren wollen gar keine Zukunft. Der letztendliche Grund, warum die María sich ins Meer wirft, ist ja, dass sie ein Gespräch belauscht, wo Alida zu Carlos sagt, wie lästig ihr María und das ungeborene Kind sind.
A: Andererseits hat Alidas Pragmatismus auch etwas Herziges, sehr Anrührendes. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass man ein Setting hat, in dem eine Frau über eine Insel herrscht, mehr oder weniger, und sich einen Saloon – das ist ja schon so eine Art Western-Saloon – einfach nimmt und zu einem Bordell umbaut. Und das sehr selbstbewusst und ohne große Schwierigkeiten damit zu haben, so ein Leben zu führen. Und auch ihre extremen Handlungen sind stark von Pragmatismus geprägt, dass sie dann die Männer, die ihre Schwester angreifen, einfach erschießt, ohne über andere Lösungsmöglichkeiten nachzudenken. Das hat etwas sehr Tolles, aber auf der anderen Seite merkt man, dass andere Menschen da überhaupt keinen Platz haben, weil es letztendlich doch vor allem um sie selbst geht. Am Ende kriegt sie ihren Wunsch und bleibt völlig alleine auf dieser Insel und in ihrem Haus zurück.
J: Auch ihre Schwester hat da keinen Platz, obwohl sie vordergründig hauptsächlich wegen ihr zur Insel gekommen ist. María ist ja auch oft aus dem Haus ausgeschlossen und lauscht an der Tür, so als wäre sie ein unwillkommener Eindringling und nicht ein natürlicher Teil dieses Hauses.
A: Oder María kann selbst nicht anders, es zieht sie immer wieder nach draußen. Sie kann sich vielleicht gar nicht auf dieses Refugium einlassen, auf die sehr dunklen und muffigen Räume in diesem Saloon. Man sieht sie dort höchstens mal im Bett liegen mit ihren Puppen, aber es wirkt nicht so, als sei sie wirklich zu Hause. Sie ist am Strand mehr in ihrem Element als in dem sehr stark von Rauschzuständen geprägten Inneren, in dieser gebärmutterartigen Welt, wohin sich die anderen Charaktere zurückziehen und rasch für die Außenwelt blind werden. Das sieht man ganz toll am Anfang, wo der Pathologe (Juan Soler) – also der Einzige, der ein genuinies Interesse daran hat, etwas aufzulösen – sofort nach der Ankunft auf der Insel mit Alkohol abgefüllt, durch eine dicke schwarze Sonnenbrille ‘blind’ gemacht und ein wenig der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Das ist natürlich auch eine Ansage an das Publikum: “Ihr denkt, es geht hier um so einen konventionellen Kriminalplot und am Ende gibt es eine Auflösung? Quatsch, das interessiert überhaupt nicht!”
J: Das macht der Film sowieso, also mit den Erwartungen der Zuschauenden zu spielen. Aber nicht so plump, wie das heute oft ist: “Oh, guckt mal, das ist alles ganz anders als ihr dachtet”, sondern viel subtiler. Bei dem Brautpaar ist das auch so. Erst denkt man: Das wird eine Geschichte von einer jungen Frau, die sich gegen ihren strengen Vater durchsetzt und den Mann heiratet, den sie liebt. Doch der Mann, den sie liebt, ist in Wahrheit ein Vergewaltiger, der später dann auch María überfällt. Und Silvia (Analía Ivars) kriegt selbst überhaupt nicht mit, was los ist. Ihr Vater (Trino Trives) hingegen hatte mit all seinen Vorbehalten recht.
A: Ja, der einfache Familienvater. In vergleichbaren Filmen wäre der vermutlich schon so eine Art Villain gewesen, der seine Tochter um ihre sexuellen Freiheit und ihr Lebensglück berauben will und sie in diesem konservativen Ort gefangen hält. Hier aber ist eigentlich er derjenige, der Klartext redet und damit Recht behält. Er wird dann nachher auch mit dem Wahrsager Miserias (Jess Franco) zusammengebracht. Der sagt ihm auch nochmal, dass alles ganz schlimm werden wird. Aber das wusste er vorher auch schon. Im Grunde ist diese Cameo-Rolle des Regisseurs als Wahrsager auf putzige Weise unnötig, weil es schon jemand anderen gibt, der das alles weiß und auch sagt.
J: Und trotzdem glaubt es ihm niemand. Bei den anderen Charakteren kommt auch nie so ein ‘Aha-Moment’. Silvia weiß ja bis zum Schluss gar nicht, was los ist. Sie geht tatsächlich als Rächerin auf die Insel und denkt, sie würde ihren unschuldigen Verlobten rächen, der von den bösen Sirenen, wie Alida und María im Film auch genannt werden, heimtückisch ermordet wurde.
A: Im Grunde ist die Tat von Silvia am Ende ein reiner Impuls, der eigentlich auf einem Missverständnis basiert, also auf dem Missverständnis, was das eigentlich für ein Mann ist und wie ihre Beziehung ist. Sie setzt anscheinend ihr ganzes Leben auf diesen Mann. Und wenn man guckt, wie der selbst damit umgeht, sobald er sich von ihr entfernt, dann ist schon sehr offensichtlich, dass sie das alles dem Falschen gibt.
J: Man weiß sowieso nicht, was die zueinander hinzieht. Sie scheinen auch fast die einzigen jungen Leute auf der Insel zu sein.
A: Das könnte der Grund sein.
J: Genau, aber das wird von ihr total romantisiert, zu so einem Romeo-und-Julia-Ding gemacht. Er hingegen wirft die Beziehung bei erster Gelegenheit weg und wollte sich eh von ihr trennen, was sie aber auch nicht verstanden hat.
A: Für sie ist das so: “Wir sind die beiden jungen Menschen hier. Wir müssen eigentlich zusammen abhauen und in die richtige Welt, ins richtige Leben übertreten”. Man fällt zunächst fast darauf herein, aber in Wahrheit kommunizieren die beiden genauso wenig miteinander wie alle anderen, weil sie sich offensichtlich überhaupt nicht kennen.
J: Mit den Erwartungen spielt der Film auch in Bezug auf Carlos. Er hat immer einen Cowboy-Hut auf, wie ein echter Western-Sheriff, obwohl er weit entfernt davon ist, für Recht und Ordnung zu sorgen. Eigentlich interessiert ihn die ganze Sache gar nicht so richtig.
A: Auch die Vorgeschichte von Carlos, wie er überhaupt da hingelangt ist, ist völlig absurd: Er hatte etwas mit der Frau des Bürgermeisters, der ihn dafür ins Gefängnis warf. Doch nach einem Skandal, wo der Bürgermeister irgendwie in Ungnade gefallen ist, musste er ihn aus der Haft entlassen. Zur Strafe hat er ihn dann an dem unliebsamsten Ort überhaupt zu einem Inspektor gemacht, was nicht gerade seinem Lebenswunsch entspricht. Deswegen stolpert er da durch die Gegend, ohne irgendewas zu tun. Er ermittelt überhaupt nichts. Es löst sich alles innerhalb der ersten paar Minuten auf. Der eigentliche Gangster in dem Film und seine Entourage haben auch überhaupt nichts mit den tragischen Sachen zu tun, die nachher passieren.
J: Man weiß nicht einmal, was dieses angeblich so große Verbrecher-Syndikat um Raul (Tony Skios) überhaupt macht. Die fahren halt immer mit Booten hin und her. Man könnte mutmaßen, die schmuggeln irgendetwas. Aber eigentlich erfährt man nichts.
A: Sie fahren sehr stylisch mit Booten hin und her, wie in einem Stillleben. Hinten ist immer die Entourage, also wer auch immer noch dabei ist, und vorne wie so eine Statue die zentrale Rolle, die gerade in dieser Transitsituation wichtig ist oder die am meisten Gravitas mitbringt. Und diese Szenen sind auch alle sehr lang und sehr schön zu gucken. Irgendwie sind sie zentral für den Film und tragen dieses Motiv der Isolation und der Unfähigkeit, Anschluss zu finden,
J: Das ist auch ein interessanter Gegensatz, wie diese ganze Umgebung auf die Zuschauenden wirkt – sommerlich, leicht, tatsächlich wie ein Urlaubsparadies – und wie sie wahrscheinlich auf die Charaktere wirkt, wenn das für den Kommissar der schlimmste Ort ist, wo er als Kommissar sein könnte.
A: Das ist interessant, weil weder die Insel noch die Küste als soziale Wüsten gezeigt werden, wo man ganz stark darunter leidet, dass es keine anderen Menschen gibt oder keine Partys. Da ist auch kein Tourismus, obwohl es total nach Tourismus aussieht. Es wirkt wie das reine Paradies. Doch da sind eben nur Figuren, die nicht mit sich alleine sein können oder auch gar nicht mit sich alleine sein sollten, weil sie dazu gar nicht in der Lage sind.
J: Selbst die paar sozialen Bindungen, die es gibt, werden gar nicht in ihren Möglichkeiten wahrgenommen. Vater und Sohn können nicht dazu stehen, dass sie Vater und Sohn sind. Die Verlobung ist eigentlich eine Verlobung zwischen vollkommen Fremden. Die Schwestern können nicht miteinander kommunizieren, obwohl es die Möglichkeiten der Gebärdensprache gäbe. Alle Optionen einer Bindung werden von den Charakteren selbst ausgeschlossen.
A: Und trotzdem haben alle ein total intensives Gefühlsleben. Das bekommt man immer wieder an den Rändern mit, also wortwörtlich: Als Andy erschossen wird nach der versuchten Vergewaltigung und seine Leiche an die Küste gebracht wird, steht sein Vater völlig gesammelt da, nimmt alles ganz stoisch hin. Aber dann, alleine zu Hause, läuft er aus dem Bild raus und man hört ihn im Raum schluchzen. Das fand ich sehr stark, weil man das überhaupt nicht erwartet hätte. Denn er ist immer abgeklärt, nach außen hin schleimig und völlig unnahbar. Er wirkt wie jemand, der nur im Hedonismus ein wenig aufgehen kann und daher gelegentlich diese Insel besucht, um ein bisschen Sex zu haben. Ein tiefes emotionales Leben würde man nicht vermuten, und plötzlich bricht das so aus ihm heraus. Aber auch nur in einer Darstellung, die seinen Körper ausgrenzt, ihn komplett aus dem Bildkader schiebt. Wir können ihn hören, wir dürfen ihn jetzt hören, aber wir sollten ihn trotzdem nicht sehen. Man kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie sein Gesicht dazu aussieht.
J: Die Kamera vermeidet diese emotionalen Tiefen, auch am Ende: Die Trauer von Alida um María und Carlos wird ja auch kaum eingefangen. Alida schreit einmal auf, nachdem María sich von der Klippe gestürzt hat und man sieht kurz ihr Gesicht, aber dann wird die Szene sofort unterbrochen, Silvia kommt und schießt auf die beiden. Im Prolog und Epilog sieht man, dass Alida überlebt hat und mit jahrelangem Abstand aufs Meer hinausblickt und denkt: “Da könnte meine Schwester liegen”. Die ganze Trauer, die vielleicht dazwischen war, ist gar nicht Teil der Filmhandlung.
A: An ihre Stelle tritt die Sehnsucht, die in diesen Bildern liegt, in dieser Beziehung zu dem Meer und zum Horizont, auch in den Transitszenen mit den Schiffen, wo die Figuren so sehnsuchtsvoll und verloren hin- und herschippern. Und natürlich in diesem tollen Musikstück, das gefühlt nie aufhört und eigentlich den ganzen Film über läuft, aber einem nie zum Hals raushängt. Es ist emotional und traurig, gleichzeitig aber auch eingängig und schön, also eigentlich wie der Film.
J: Und wenn Alida dieses Lied selbst anstimmt, in dieser Szene am Anfang, wo es so aussehen soll, als wenn sie das Lied selbst singt, dann passt das ja überhaupt nicht zusammen. Wie sie versucht, auf der Gitarre die Finger anzusetzen, das wirkt überhaupt nicht so, als würde sie wirklich spielen. Es wird auch gar nicht versucht, dass irgendwie rüberzubringen, obwohl der Film sonst so realistisch ist. Sie kann ihr Lied nicht spielen, aber es ist trotzdem überall und durchdringt jedes Bild.
A: Bahía blanca funktioniert einfach überhaupt nicht wie ein Genre-Film. Die Szene erinnert ja auch ein wenig an River of No Return (Preminger, USA 1954), wo Marilyn Monroe in einem Western-Saloon sitzt, und – natürlich mit perfekter Synchronistation – etwas singt, das sie selbst zuvor in einem Tonstudio eingespielt hat. Die Magie des klassischen Hollywood-Kinos, wo Gesang, Musik und Akkustik in makelloser Einheit zusammenkommen, wird von Jess Franco richtig lustvoll gegen die Wand gefahren. Genauso macht er es mit seinem eigenen Gastauftritt als El Meserias: Die tolle Geschichte über die Sirenen auf der Insel, die in einem Horrorfilm ein großartiger Stimmungsaufbau wäre, wird total dadurch torpediert, dass er die ganze Zeit eine Hand vorm Mund hat, da er sich in seinem eigenen Film anscheinend gar nicht selbst spricht.
J: Und was er erzählt, ist ja auch eigentlich Unsinn. Er sucht zwar in den Untiefen, die alle anderen meiden, aber er sucht an der falschen Stelle. Statt die Tiefe in dem Gefühlsleben, den Sehnsüchten oder den Beziehungen der Leute zu suchen, sucht er sie am Boden seiner Kaffeetasse, im Kaffeesatz. Klar kommt es zu einer Katastrophe, aber nicht aufgrund der Dinge, die er denkt. Er denkt ja, die Frauen auf der Insel, also Alida und María, würden das Unglück hervorrufen. Aber abgesehen von Marías Selbstmord haben sich alle Figuren ihr Unglück selber zuzuschreiben, und Alida wird ja sogar selbst zu einem Opfer ihrer Handlungen.
A: Die einzige Frau, die sich am Ende wirklich als gefährlich erweist, ist Silvia.
J: Und dabei ist sie diejenige, die am Anfang gar nicht so erscheint, sondern als helle, strahlende Figur. Die glückliche junge Verlobte. Sie ist auch die Einzige, die Gefühle zeigt, ganz theatralisch, vor allem als sie am Steg niederfällt, wenn Andy tot an Land gebracht wird. Aber als Zuschauende weiß man die ganze Zeit, dass das alles nur in ihrem Kopf ist. Eigentlich setzt sie nur ein eigenes Drehbuch um, das aber mit der Realität im Film überhaupt nichts zu tun hat.
A: Letztendlich ist das auch eine Übersprunghandlung. Es gibt ja gleich zwei Übersprunghandlungen am Ende des Films. Die beiden Frauen, die damit den Tod über sich und andere bringen, werden sogar gespiegelt: Sylvia wirkt immer so, als sei sie in Kontrolle. Sie hört auf niemanden und scheint völlig selbstbestimmt. Und am Ende ist sie dann durch Andys Tod hypnotisiert, fährt wie eine Art Zombie im Hochzeitskleid mit ihrem Gewehr verträumt auf die Insel zu. Andererseits schien María die ganze Zeit über von ihren Impulsen hin und her geworfen zu werden. Sie hat diese Sehnsüchte, denen sie aber noch nicht recht folgen kann, wird aber in dem Moment, in dem sie sich in Richtung des Meeres stürzt, zu einer völlig aktiven Figur, die in ihrem Selbstmord auch Kontrolle über ihr eigenes Leben übernimmt.
J: Ja, für sie ist das eine Art, Kontrolle zu erlangen, und zwar nicht nur als Gegenwehr gegen die Männer, die ihr drohen und sie missbrauchen, sondern auch gegen ihre Schwester.
A: Das ist auch wahnsinnig toll gemacht, weil sie in diesem Moment mit der Filmtechnik verschaltet wird. Dazu gibt es eine frühe Sequenz, die diesen Effekt vorbereitet, dort wo sie an diesem holzumrandeten Pavillon am Strand lehnt. Nach einem Wortabtausch mit der Schwester läuft sie aus dem Bild. Der Blick ruht noch auf der Wand des Pavillons und dann verlagert sich der Schärfebereich der Kamera: Wir können nun durch die Wand hindurchsehen, die Kamera schwenkt nach links und man hat sofort knackenscharf das Meer in dieser überwältigenden Flächigkeit vor sich. Das kommt am Ende, wenn sie sich in die Schlucht stürzt, nochmal umgekehrt: Wir sehen sie bei diesem Akt gar nicht. Stattdessen gibt es einen ganz schnellen Zoom in den Felsenbereich, auf den sie vermeintlch zuspringt, und dann shiftet der Fokus in die ebenfalls flächige Unschärfe des Objektivs. In diesem Moment, in dem sie die Kontrolle ergreift, ergreift sie auch die Kontrolle über die Technik, über die Kamera, über alles, was in diesem Film neben dem Musikstück noch direkte Macht über das Publikum hat.
J: Gleichzeitig entzündet sich alles auf der Handlungsebene: Während der Film die ganze Zeit über so verführerisch plätschert, passiert am Ende alles innerhalb weniger Sekunden. María ist auf den Felsen, Silvia läuft mit ihrem Gewehr über den Strand und Alida und Carlos laufen Richtung Bucht. Es fallen zwei Schüsse und es ist vorbei. Dann kommt noch der Epilog, der an den Prolog anschließt, also dann viele Jahre später gespielt, wo Alida schon älter ist und abends auf den Steg zieht und auf die Leere hinaus schaut.
A: Es wäre einfach, hier von einer ‘Banalität der Gewalt’ zu sprechen, die sich erschreckend natürlich und irrational niederschlägt. Aber das legt der Film überhaupt nicht nahe. Der Epilog, in dem Alida noch einmal darüber spricht, was sie einmal hätte haben können und auf was sie jetzt noch zurückblickt, drückt einen Fatalismus aus, der von den vorherigen 90 Minuten überhaupt nicht getragen wird. Vielmehr scheint Franco uns entegenzurufen: “Guck mal, die Sonne scheint! Da ist irgendwie diese Weite, wir haben diese schöne Musik und wir sehen Menschen, die einfach so ihre Leben leben, obwohl sie nichts damit transzendieren können. Sie bleiben nur Fleisch und Blut, und dieses Fleisch ist wandelbar, das kann einfach verschwinden.” Und das einzige, was an ernstem Transzendenzvermögen vorhanden ist, das ist diese Sehnsucht nach dem Verschwinden in der Fläche, die sich am Ende nur für María erfüllt. Alida hingegen bleibt mit ihren ‘morschen Knochen’ auf dem Steg zurück und wird für immer in das massige Innenleben ihres Hauses zurückgezogen werden.