
Darum geht’s: Jim Anderson (Robert Young) ist das archetypische Oberhaupt einer US-amerikanischen Vorstadtfamilie. Zwischen 1949 und 1954 erlebten die Andersons alltägliche Abenteuer in ihrer live aufgenommenen Radio-Sitcom. Hausfrau Margret (Jane Wyatt), Töchter Betty (Elinor Donahue) und Kathy (Lauren Chapin) sowie Sohn Bud (Billy Gray) sind Dreh- und Angelpunkt verschiedener Herausforderungen und Probleme, die unter den so naiven wie eitlen Bewältigungsversuchen des Vaters regelmäßig eskalieren.
Besprochene Episoden (zum Anhören klicken):
The Elusive Card Game (29.12.1949)
Family Spending (05.10.1950)
Emancipation (31.01.1952)
Should Women Work? (25.09.1952)
A: Lust auf Kaffee?
J: Die Kaffee-Werbung ist immer das Beste.
A: „Always good…to the last drop“.
J: Allein deshalb lohnt es sich, das zu hören. Das ist erstmal kurios. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist es eigentlich so ähnlich wie heute. Da wirst du ja auf YouTube auch mit den immer gleichen zwei, drei Spots genervt, bis mal irgendwas Neues kommt.
A: Ja, eigentlich hat man sich wieder dahin bewegt, wie es früher beim Radio war, dass man so ein, zwei Sponsoren hat, und die begleiten die ‘Sendung’ die ganze Zeit über.
J: Damals waren es aber richtig lange Werbespots. Der erzählt ja ewig von seinem Kaffee.
A: Das verschmilzt in dieser stoischen Penetranz vollkommen mit der Show und geht irgendwann ins Blut über. Man ist dann völlig schockiert, wenn nach Dutzenden Folgen plötzlich für eine andere Marke geworben wird. Und die ist dann auch noch entkoffeiniert!
J: Ja, das geht gar nicht! An der Serie zwischen der Kaffeewerbung finde ich aber interessant, dass sich hier so ein Muster einspielt, das man heute noch von Peppa Pig (Astley/Baker, UK 2004-) bis Hurra Kinderlieder (Hohage, D 2017-) sehen kann: Eine traditionelle Familie mit einem etwas trotteligen Vater, daneben eine unscheinbare Mutter, die in ihrer traditionellen Rolle einfach da ist, aber kaum individualisiert wird, und dazu Kinder in verschiedenen Altersstufen, die Quatsch machen und die Handlung vorantreiben. Das ist schon nicht mehr dieses klassische Patriarchat, mit dem unheimlich bestimmenden und kompetenten Vater, sondern fast schon eher eine Karikatur des Patriarchats.
A: Das stimmt, wobei ich finde, dass die Mutter und der Vater beide starke Archetypen spielen. Jim ist der Protagonist, aber man erfährt ansonsten wenig über ihn. Er existiert genauso wie Margret eigentlich nur im Kontext der Familie. Die Kinder sind die einzigen Charaktere, dies so etwas wie eine Individualität haben dürfen. Klar, die haben auch immer ihre Standardsituationen und Catchphrases – von „Gee Whiz“ bis „Holy Cow“. Aber die Handlung wird nicht selten durch ihre wechselhafte Beziehung zu den Eltern und zur Außenwelt bestimmt, wohingegen Mutter und Vater immer sehr konstant bleiben.
J: Ja, das trägt auch ein neues Bild der Kindheit mit. Wenn du Gesellschaftsromane aus dem 19. oder beginnenden 20. Jahrhunderts liest, dann sind die Erwachsenen im Fokus und die Kinder eher so Anhängsel. Selbst bei Effi Briest (Fontane, D 1894/95), wo es letztendlich um eine Art Sorgerechtsstreit geht, bleibt das Kind komplett blass. Das ist hier schon anders, die Kinder sind sehr stark im Zentrum.
A: Diese klassische Kernfamilie – Mann, Frau, drei Kinder – , die vielleicht auf dem Papier nicht unbedingt neu ist, aber zumindest gesellschaftlich in den 1950ern ganz anders gesehen wurde, ist in dieser Hinsicht wirklich modern: Die Kinder sind nicht einfach Anhängsel oder spätere Brotverdiener, die einfach so mitlaufen, sondern sie haben eigene Persönlichkeiten, die sich im Haushalt entfalten. Die Eltern entwickeln sogar eine Abhängigkeit zu ihren Kindern und die ganze Familie ist dadurch aufeinander geworfen.
J: Das ist ja in der Emancipation-Folge sehr stark, da hat man total dieses Bild: Als Paar kann man nicht viel miteinander anfangen, aber man hat die Kinder und das hält die Familie zusammen. Selbst der Vater kreist um die Kinder, nicht nur die Mutter. Sobald er nach Hause kommt, ist er komplett in der Erziehungsarbeit drin. Und das geht dann ja bis zu den Großeltern, die sich immer um ihre Enkelkinder kümmern: Alle Erwachsenen sind auf die Kinder ausgerichtet. Das ist schon ein sehr anderes Bild verglichen mit dem, wie man eine Gruppe von Erwachsenen vielleicht 50 Jahre vorher gezeichnet hätte.
A: Das ist bestimmt auch so ein bisschen dieses Sitcom-Genre, aber es ist halt nicht dieses Bild, das man vielleicht erwarten könnte: Der Vater muss sich um nichts kümmern, er kommt von der Arbeit nach Hause und alles ist gemacht, die Kinder sind versorgt.
J: Das ist nicht so, das stimmt.
A: Er ist immer sofort mittendrin und stellt alles auf den Kopf, meistens durch irgendwelche schlauen Ideen oder Weisheiten, oder er versucht irgendetwas in seiner Rolle als Vater durchzusetzen. Und das geht dann katastrophal schief, was aber oftmals einfach daran liegt, dass die Familienmitglieder alle ihren eigenen Kopf haben und eine ganz eigene Interpretation dessen, was er gesagt hat, oder auch daran, dass er selbstmächtig etwas anstellt oder auslöst, was er überhaupt nicht vorhergesehen hat. Weil er eben oft Sachen vor sich hersagt, bei denen man das Gefühl hat, dass er damit – ohne es zu merken – den Zeitgeist mitträgt. So etwas gab es in den späteren Fernsehserien der 1950er weniger, dass der Zeitgeist – also auch Sachen, die damals so richtig ‘cutting edge’ waren – mit aufgenommen und verarbeitet wurden, auch wenn sie vielleicht etwas kontrovers ankommen könnten. Zumindest nie ohne das doppelte Netz, das hier im Radio noch manchmal fehlen darf.
J: Da ist auch die Folge Should Women Work? ganz interessant. Da wird ja schon mitgetragen, wie sehr diese Familie sich selbst konstruiert. Der Vater stachelt die Kinder richtig an, der Mutter vorzuspielen, wie traurig sie wären, wenn sie arbeiten gehen würde. Da wird selbst abgesprochen, wer wann weinen soll. Der Sohn stellt das total gut dar, weil er immer wieder diesen Ausspruch, den der Vater eigentlich als eine Art emotionaler Erpressung sagt: „I don’t feel happy inside“, auf das zurücklenkt, worum es ihm eigentlich geht, nämlich darum, ob die Kartoffeln fürs Abendessen gekocht sind oder Ähnliches. Er bezieht „I don’t feel happy inside“ nur aufs Essen und zieht damit diese emotionale Erpressung ins Lächerliche.
A: Wobei das ja auch eine Erpressung ist, die völlig ins Leere läuft, weil es ja in Wirklichkeit darum geht, dass Margret einen Vortrag halten soll, in so einem Debattier-Club, über das Thema, ob Frauen – also Ehefrauen – arbeiten sollten. Jim denkt hingegen, sie würde tatsächlich mit diesem Gedanken spielen, dabei spricht sie sogar für die Gegenseite. Aber das fand ich eh schon total spannend, dass das Anfang der 1950er so offen verhandelt wurde, dass man in solchen sozialen Kontexten darüber spricht und in Magazinen schreibt.
J: Ja, in so einem Kontext, wo es um die „heile Kernfamilie“ geht, ist das in der Zeit fast schon ein Tabuthema, das die da aufgreifen.
A: Und ich hatte die ganze Folge über das Gefühl, dass – wie du schon sagtest – einerseits die Konstruiertheit der Familie rauskommt und andererseits die Mutter eigentlich diejenige ist, die die ganze Macht hat. Und das ist ja ein Topos, der bis heute in diesen Serien verankert ist, dass du das Patriarchat darüber konstruierst, dass der Vater im Alltag der schwächere Pol in der Vater-Mutter-Konstellation ist, aber die Ehefrau gnädigerweise hinwegsieht über seine Fehler oder über die Unvollkommenheit dieser Ehe, zum Wohle der Familie.
J: Genau, wobei aber natürlich alle größeren gesellschaftlichen Bewegungen in diesem Topos ausgeblendet werden, da du immer den Fokus auf der Kernfamilie hast. Ein wichtiger Grund, warum die Frauenarbeit in den 1950er-Jahren zumindest unterschwellig ein Thema war, wird ja auch gar nicht genannt: Nämlich, dass in der Kriegszeit die Frauenarbeit gebraucht wurde. Und als die Männer aus dem Krieg zurückkamen, sollten die Frauen wieder aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden. All das wird hier ausgeblendet, die Familie scheint ziemlich isoliert zu existieren, als so eine Art Insel, auf die diese ganzen gesellschaftlichen Strömungen gar nicht einwirken. Diese Illusion wird stark gefördert. Und dann erscheint die Frau sehr mächtig in dem Moment, aber was vielleicht noch an größeren gesellschaftlichen Kräften auf sie einwirkt und sie daran hindert, einen Beruf zu ergreifen und selbstständiger zu werden, das wird durch diese Insel-Illusion unsichtbar gemacht. Es wird nur auf die fünf Familienmitglieder geschaut, und dann liegt die Macht natürlich bei ihr zu sagen: „Ich mache das oder ich mache das nicht“.
A: Absolut! Dennoch geht das Skript gewisse Risiken ein. Wenn es wirklich ein Anliegen gewesen wäre, sich abzusichern, hätte man es zum Beispiel auch ernster damit nehmen können, dass es für Frauen vielleicht gar nicht so große Chancen gibt. Stattdessen wird eher ein Szenario gezeichnet, dass die Männer in Angst versetzt, so als würde eine Karriere prinzipiell jeder Ehefrau ohne Weiteres offenstehen. Das ist schon wie eine Utopie in dieser Folge. Also klar, einerseits blendet man damit Realitäten und Ideologien aus, aber andererseits macht man einen Spielraum auf, gerade auch für die Hörerinnen. Und Frauen waren ja ein sehr großer Teil der Hörerschaft, sehr wahrscheinlich der größte. Deswegen wendet sich die Kaffeewerbung auch immer direkt an sie. Da kommt ja der Ehemann nur so vor, dass er der große Schiedsrichter darüber ist, ob der Kaffee wirklich so gut ist wie behauptet. Und auch für die Töchter ist das ja eine lehrreiche Episode. Man kann sich ja schon vorstellen, dass die Mädchen, die diese Diskussion mitkriegen, sich später vielleicht anders entscheiden werden, wenn sie in der gleichen Situation sind.
J: Ja, man kann es so sehen, dass sich der jüngsten Tochter innerhalb der Serie ein Möglichkeitsraum eröffnet, gerade weil sie mitbekommt, dass die ganze Idee vom drohenden Zerfall der Familie durch die Berufstätigkeit der Mutter nur eine billige Inszenierung ist.
A: Und dieser Möglichkeitsraum wird aufgrund der Inkompetenz des Vaters kaum gedeckelt. Es ist völlig klar, dass er wieder aus dem Bauch raus etwas vor sich hin sagt, von dem er meint, dass er es in seiner angestammten Rolle vertreten muss: „Meine Frau wird nie arbeiten gehen. Das kommt gar nicht in die Tüte“. Und aufgrund dieser chauvinistischen Haltung tut die Mutter dann so, als würde sie ein Model werden wollen. Und das stürzt die ganze Familie dann in eine Panik. Man hätte sich ja tausend Szenarien überlegen können, was der Vater alles erzählen kann, damit noch eine lehrreiche Moral dabei rauskommt. Oder man hätte die Rede einspielen können, die die Mutter im Debattierclub halten soll, wo sie sich leidenschaftlich für die Rolle der Ehefrau ausspricht. Aber das ist der Show überhaupt nicht wichtig. Das ist ganz anders wie so einige Sachen, die man aus dem deutschen Fernsehen dieser Zeit kennt, wie das, worüber wir neulich bei der Fernseh-Doku Diese Sendung ist kein Spiel – Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann (Schilling, D 2023) gesprochen haben, die sich mit Aktenzeichen XY ungelöst (Zimmermann, D 1967-2021) auseinandersetzt. Dieser Serie war es anscheinend immer ein großes Anliegen, Frauen zu vermitteln, welche Rolle sie in der Gesellschaft haben und was ihnen Schlimmes passieren kann, wenn sie davon abweichen. Aber das hier ist 15-20 Jahre vorher ein viel spielerischer, leichterer Raum, und dies innerhalb einer Show, die natürlich trotzdem sehr konservative Werte vermittelt. Allerdings eben mit einer gewissen Risikobereitschaft.
J: Wenn man das vergleicht mit Romanen, die nur so 50 Jahre vorher veröffentlicht wurden, da war es ein viel selbstverständlicheres Patriarchat, in dem diese Rolle – zumindest im Bereich des Fiktiven – durch eine echte Kompetenz getragen wurde. Das wirkt hier sehr viel unnatürlicher. Und auch der Vater ist ja, wie die Mutter, an dieses Haus gebunden. Dieser klassische Drinnen-Draußen-Dualismus, der das Patriarchat seit der Antike trägt, besteht hier gar nicht mehr. Also gerade in der Folge Emancipation, wo es ja nicht um die Frauenemanzipation geht, sondern um die Emanzipation der Eltern von den Kindern, wird der Vater als genauso im Innenraum des Hauses gebunden gezeichnet wie die Mutter.
A: Und selbst draußen sind beide noch irgendwie zu Hause: Das Einzige, was Jim einfällt für einen Abend ohne seine Kinder, ist sein Lieblingsrestaurant oder so ein Bowling-Palast, was beides eigentlich mehr eine Verlängerung seines Wohlfühlraumes ist.
J: Und als die nicht zu haben sind, ist das Einzige, was ihm einfällt, zu Hause zu sitzen und Canasta spielen, was eigentlich eher so ältere Damen machen.
A: Dass sie nicht auf Sex kommen, ist auch interessant.
J: Ja gut, dass konnte man vielleicht damals im Radio nicht sagen.
A: Man konnte es wohl, im Gegensatz zu späteren Sitcoms, nicht mal andeuten. Aber das Ganze zeigt seine Hilflosigkeit und offenbart, dass der Mann auch total domestiziert ist. Er ist kein Abenteurer, er hat auch kein gesellschaftliches Leben. Als die Kinder dann weggehen und die Eltern alleine lassen, reagiert er so: „Ach, bleibt doch hier. Ihr braucht mich bestimmt“. Also diese merkwürdige Art, dass man sich komplett über die Kinder definiert, da hat man eigentlich nur diesen Innenraum. Klar, er hat irgendwo einen Job, aber das wird nie groß erwähnt.
J: Irgendwie sind die beide sehr an dieses Haus gebunden. Wer rausgeht und wieder reinkommt, das sind eigentlich eher die Kinder.
A: Genau, und die verursachen dann auch manchmal Probleme. Es gibt eine Folge, da bringen die von draußen ein Stinktier mit. Oder in der Emancipation-Folge, wo er selber die Kinder raus jagt, um sich dann sofort zu beschweren, dass die alle einfach so gegangen sind, ohne Einwände, und er sich völlig verlassen fühlt. Aber dann kommen sie wieder und bringen jede Menge Probleme, die er dann lösen kann.
J: Ja, es sind echt die Kinder, die mobil sind, und zwar – das spricht für diese moderne Ausrichtung des Lebens – die Töchter genauso wie der Sohn.
A: Die ältere Tochter hat ‘draußen’ sogar Dates, und da wird überhaupt nicht so moralisierend drauf geguckt, wie das ja selbst in den Sitcoms der 80er-Jahre teilweise der Fall war. Hier spürst du eher so eine Hilflosigkeit.
J: Ja, der Kontrast zwischen den Generationen, der ist hier schon stärker als der zwischen Mann und Frau.
A: Und die Hobbys des Vaters, die sind entweder auch total über die Familie definiert oder er wird von der Familie an ihnen gehindert. Also eine Folge gibt es, die heißt The Elusive Card Game. Da geht es darum, dass er sich am Anfang beschwert, dass die Kinder immer ausgehen wollen, bei Freunden übernachten und so. Und da meinte er: „Nein, heute bleiben wir alle zu Hause. Das entscheide ich jetzt.“ Und dann fällt ihm ein, dass er eigentlich ein Kartenspiel für den Abend angesetzt hatte. Und dann versucht er den ganzen Abend, irgendwelche Ausreden zu finden, um rauszugehen, also er versucht alles Mögliche zu konstruieren, um zu diesem Kartenspiel zu kommen. Und sei es nur für eine halbe Stunde. Aber er kann das vor seiner Familie nicht zugeben, weil er den großen Macker gemacht hat: „So, wir bleiben alle zu Hause, das ist das Beste für die Familie.“ Dabei wollte er eigentlich selbst ausgehen.
J: Alles wird im Grunde durch die Familie gefiltert. Und meistens kommt das am Ende nicht so gut wieder raus, also nicht so, wie er sich das vorstellt in seiner irgendwie unabhängigen, irgendwie starken männlichen Position.
A: So ist es auch bei der Folge mit der Türverkäuferin, wo er komplett daran scheitert, ein Haustürgeschäft zu machen.
J: Also es ist natürlich auch interessant, dass er im Haus sitzt und wartet, dass jemand kommt und etwas anbietet. Er geht nicht raus, um irgendwas zu besorgen. Das ist ja in allen Folgen so, die wir gehört haben. Die Eltern sind immer nur zu Hause und Sachen kommen von außen rein.
A: Hier auch wieder diese ganzen exotischen Magazine, die die Mutter gekauft hat – Hühner, Hühnerzucht und solche Geschichten. Das Vogellexikon und so.
J: Genau, das zwölfbändige Vogellexikon.
A: Und er muss sie erstmal groß belehren, dass sie nicht immer solchen ‘nutzosen Unfug’ kaufen soll. Aber dann bekommt er einen Anruf von einem Kunden, dass dessen Tochter zu ihm kommen würde, und er solle ihr etwas abkaufen und würde das Geld dann von ihm zurückbekommen. Also im Grunde ja auch so ein total krasser, chauvinistischer Move, da der Kunde seiner eigenen Tochter eigentlich Geld geben will, aber die möchte das nicht, sie will auf eigenen Füßen stehen, und dann machen die Männer das irgendwie um zwei Ecken. Aber nicht mal das kriegt er hin, weil sie die falsche Frau ins Haus zerren, die dann Lingerie verkauft.
J: Er kauft dann auch super viel Quatsch.
A: Für die Zeit ist das Ganze aber auch sehr gewagt. Vor allem hätte ich es nie kommen sehen, dass die Kinder alle dabeistehen, von der Kleinsten bis zum ältesten Sohn. Alle gucken, wie die Verkäuferin da die Unterwäsche auspackt. Und der Vater muss das alles über sich ergehen lassen, weil natürlich niemand weiß, was los ist und warum er diese Sachen kauft. Das ist eine absurde Situation, aber es brechen plötzlich auch so ein bisschen Sexualität und körperliche Freuden durch.
J: Auch wenn das alle natürlich abwehren: „Also was soll denn das hier, das ist ja so ein Fremdkörper“.
A: Aber nicht ohne eine große Portion Dissonanz: Die älteste Tochter sagt sofort zu diesem Nightgown: „Oh wie wunderbar“, aber dann kommt die Mutter und meint: „Sowas würde ich niemals anziehen“. Aber irgendwie wird es trotzdem von allen als etwas eigentlich Attraktives und Begehrenswertes wahrgenommen. Diese Verklemmtheit wird schon wieder ins Lächerliche gezogen.
J: Da ist wieder diese Konstruiertheit. Man hat das Gefühl: „Okay, die Familie denkt über sich selbst, dass sie so oder so zu sein hat. Danach gestaltet sie ihren Alltag. Und das ist auch der Punkt, wo ganz oft Chaos losbricht, weil das, was sie denken, tagtäglich tun und sagen zu sollen, sich mit dem bricht, was sie eigentlich wirklich tun möchten, oder mit anderen Aspekten ihrer Persönlichkeit in Konflikt gerät, die man dann gar nicht so direkt zu hören bekommt. Man nimmt mehr die Resultate dieses Clashs wahr.
A: Und die resultierenden Scherben sind, so lustig oder temporär sie auch sein mögen, doch oftmals so unheimlich nah an den realen Vorbildern dran, dass diese hinter ihrem „White Fence on Maple Street“ eigentlich aufgehorcht haben müssen. Immerhin setzt die Show nachdrücklich und fast schon rituell auf Identifikation.
J: Ja, da gibt es zum Beispiel auch immer dieses „Meet your Neighbors the Andersons“ am Anfang. Jeder soll sich vorstellen, die leben in der eigenen Nachbarschaft. Der Vater ist auch ein archetypischer Amerikaner, ein Joe Everybody. Das macht es noch mal interessanter, wenn man das Gefühl hat: „Oh, wenn ich mich jetzt damit identifiziere, dann könnte das auch in mir Widersprüche auslösen“. Die gesamte Show wird damit auch zu einem Filter für die Familien zu Hause, durch den sie ihre eigenen Haltungen und Gedanken schicken können. Die kommen dann vielleicht nicht mehr ganz so zurück wie erwartet.
A: Zumindest für die Familien vor dem Radio trifft das zu. Father Knows Best wurde ja ab 1954 auch ins Fernsehen übertragen. Aber die Serie ist völlig anders, der Vater hat da wieder diese selbstverständliche Autorität. Es ist immer noch so, dass er dann manchmal ein bisschen trottelig ist. Aber das wird alles wieder eingefangen. Es wirkt so, als hätte der Mediensprung dem Format die Zähne gezogen. Ich frage mich, ob das vielleicht auch mit dem Fehlen oder Vorhandensein der visuellen Komponente zusammenhängt. Man kann ja ganz viel über Körpersprache machen, gerade auch in sehr formellen Gesellschaften, die auf bestimmte Schlüsselreize reagieren. Klar, die Stimme haben wir auch im Radio, aber die ist vielleicht noch vielseitiger interpretierbar, als wenn man dasselbe in einem Bild festlegt.
J: Und das Fehlen der visuellen Komponente führt auch dazu, dass man sich vieles als Zuschauer selber ergänzen kann, die Figuren im Raum und ihre Körpersprache. Sicher, die Stimme gibt einem vielleicht Hinweise, aber man hat sehr viel mehr Freiraum, einem eröffnen sich Möglichkeiten durch die Erzählung. Vielleicht haben das damalige Hörerinnen und Hörer daher auch ganz anders wahrgenommen als wir heute.
A: Ja, das ist wirklich bei diesen Radio-Plays so, dass jede Stimme noch eine ganz andere Geltungsfähigkeit hat. Jede Stimme ist im Grunde erstmal gleichwertig im Raum verteilt. Wenn du hingegen ein Bild in einer Fernsehserie hast, kannst du alleine dadurch, wo die Charaktere stehen oder sitzen, schon eine Auswahl treffen und einigen mehr Gewicht verleihen als anderen. Klar, das kannst du im Radio auch über Häufigkeit des Sprechens regeln. Wenn der Vater am meisten spricht, dann merkst du: Okay, er ist anscheinend die wichtigste Person. Aber trotzdem haben die Stimmen ein sehr starkes Eigenleben. Die Tochter ist ja eine der lautesten Sprecherinnen in der Serie. Dass sie so laut ist, das wird stark thematisiert und daraus wird auch sehr oft Humor gezogen, weil sie so laut und immer instinktiv aus dem Bauch raus ist. Aber das zieht auch ganz viel Aufmerksamkeit auf sich. Daher glaube ich auch schon, dass allein dadurch, dass man sich vorstellen muss, wie die Stimmen im Raum verteilt sind, das Ganze anders wirkt als nachher im Fernsehen. Bei den paar Folgen, die ich gesehen habe, gibt es diese klassische Anordnung: Die Familie sitzt am Tisch, der Vater ganz zentral in der Mitte und alle anderen drum herum.
J: Wenn ich diese Radiosendung höre, dann stelle ich mir vor: Der Sohn liegt irgendwo und ist mit seinen Gedanken woanders, hat Hunger und beschwert sich ab und zu. Die Tochter springt vielleicht gerade auf der Couch rum. Also, es wirkt alles viel unaufgeräumter und chaotischer, und überhaupt nicht so wie dieses klassische Bild: So hier ist alles schon geordnet und jeder hat seinen Platz im Haus. Die Mutter ist in der Küche und der Vater hier in der Werkstatt.
A: Es wirkt wie ein Haushalt, in dem sehr viel Bewegung ist. Das hat ja teilweise echt so Slapstick-Elemente, wo alle reinstürmen: „Oh, hier ist das Problem. Geh mal in den Keller. Oh, komm wieder rauf. Oh nein, jetzt brennt es gerade ganz woanders“. Und das ist im Fernsehen ganz stark ruhiggestellt, da kommt wieder so eine ordnende Instanz rein. Vielleicht misstraut man dem Bild doch einfach mehr als dem Ton. Dass dem Radio, gerade weil man es nicht sehen konnte und es dadurch alles mehr im Bereich der Fantasie liegt, mehr Spielraum eingeräumt wurde als dem fotografischen Bild, das so eine Zeugnisfähigkeit hat, wo man sich als Zuschauer vielleicht zu sehr im Bereich des Dokumentarischen wähnt. Deshalb überlegt man sich vielleicht nochmal anders, wie man die Sachen bildlich darstellt und wie viele Risiken man da eingeht.
J: Ich denke, das stimmt. Im Grunde hat das Fernsehen seinen eigenen Filter, der sich dem Bildlichen als Maßstab der Sendefähigkeit annimmt. Diese Kontrollinstanz war beim Radio zumindest noch liberaler, und gelegentlich durfte sie auch mal weghören.
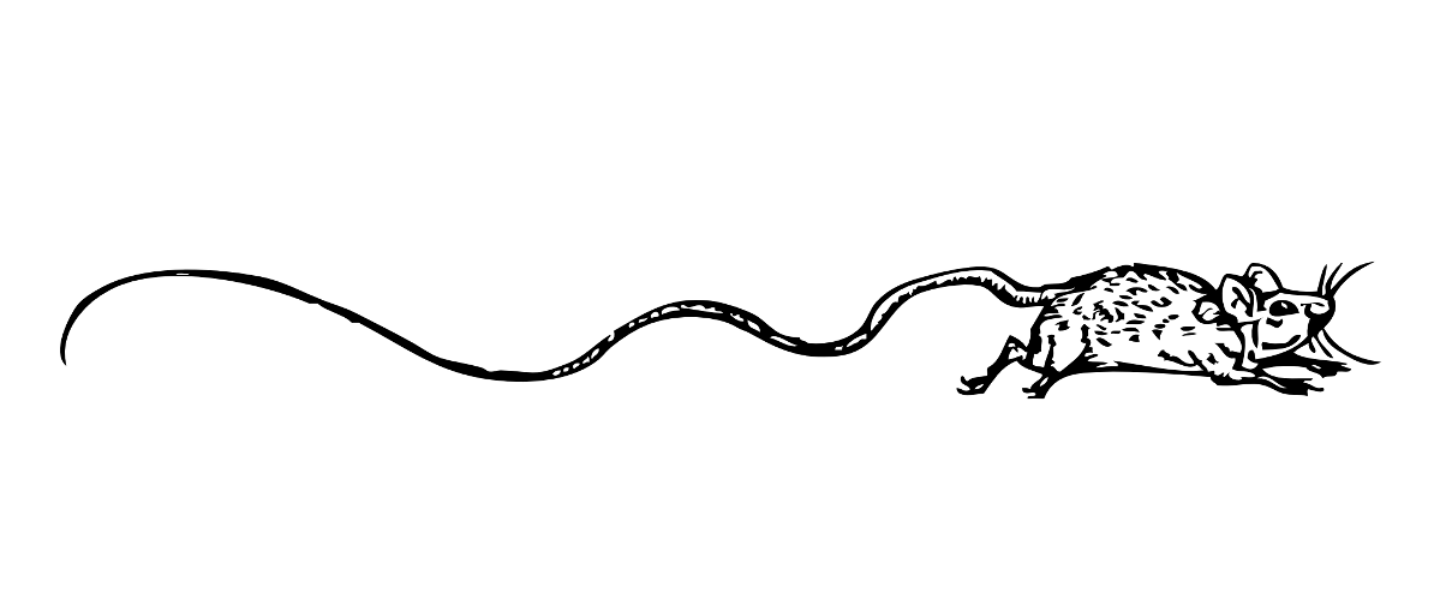
[…] auch Geschäftsführerin. Und der Film ist nur ein paar Jahre nach der Should Women Work-Folge von Father Knows Best […]