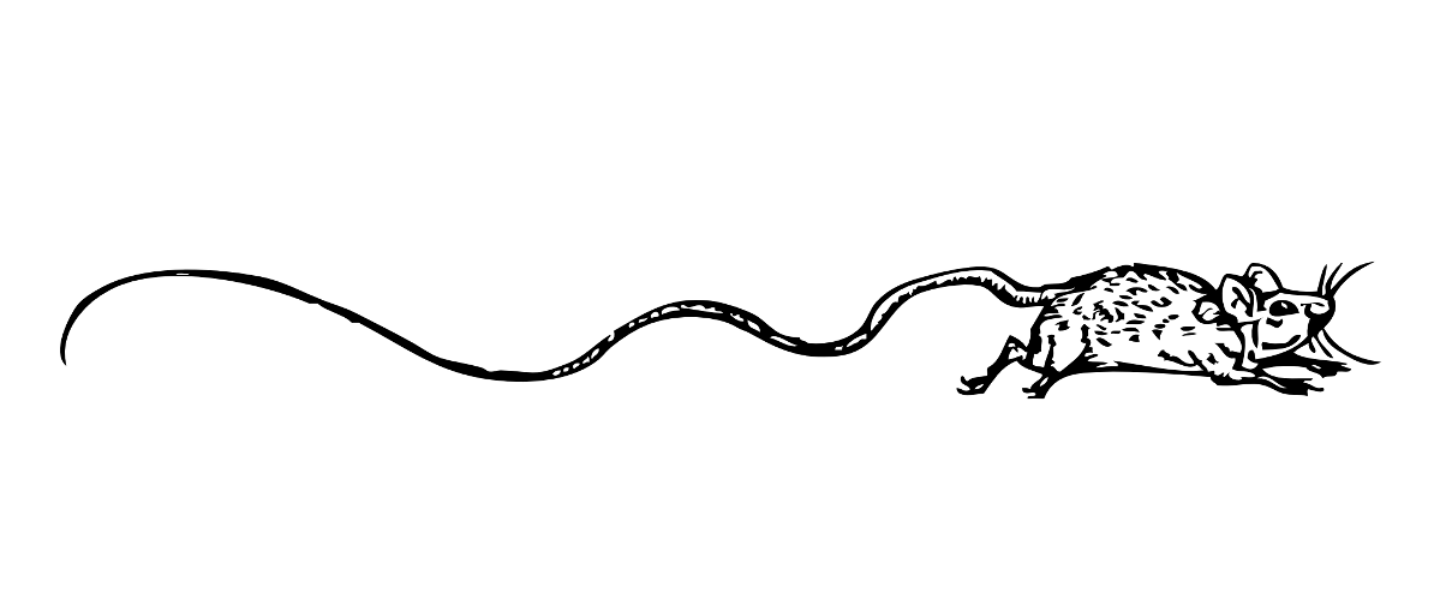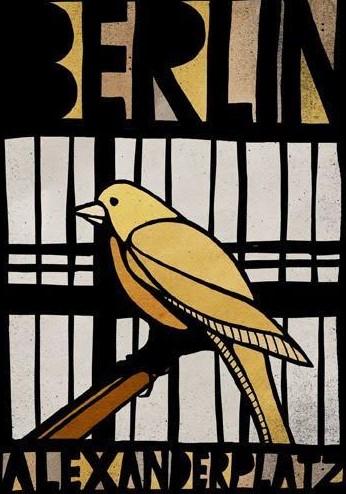
Darum geht’s: Der wegen Totschlags an seiner Partnerin Ida verurteilte Franz Bieberkopf wird im Jahr 1928 aus dem Gefängnis entlassen und schwört sich, ehrlich zu bleiben. Allein in dem von Wirtschaftskrise und politischen Unruhen gebeutelten Berlin gerät er aber schnell wieder in das Milieu der Kleinkriminellen. Nach mehreren kurzen Beziehungen geht er eine feste Partnerschaft mit der Sexarbeiterin Emilia ein. Doch da ist auch die Freundschaft mit Reinhold, der ein für beide unaussprechliches Begehren zugrunde liegt. Als Reinhold Emilia ermordet, driftet Franz Bieberkopf in den Wahnsinn ab.
Achtung: Schwere Spoiler!
J: Zuerst ist mir aufgefallen, dass der Film sehr dunkel ist und die Orte sehr ruhig sind. Ganz anders, als man das von so einem Großstadt-Film erwarten würde. Der Roman schreibt sich ja schon in den typischen Großstadt-Diskurs der 1920er Jahre ein, wonach die Stadt so laut, so schrill und so grell ist. Das ist hier eigentlich nur repräsentiert durch dieses lila Werbelicht, das nachts immer in Franz Bieberkopfs Zimmer hineinblinkt. Ansonsten wirkt alles sehr beschaulich, fast schon dörflich. Immer die gleichen Straßen und Gassen. Man findet sich auch als Zuschauer schnell zurecht.
A: Ja, und trotzdem wirken viele der Charaktere so, als seien sie nervlich geschädigt. Ganz besonders natürlich Franz Biberkopf, aber auch die anderen. Das geht schon über normale Neurosen hinaus, und deutet darauf hin, dass da vielleicht doch die Stadt irgendwie zugeschlagen hat.
J: Aber es verbleibt im Unsichtbaren, wie die Stadt zuschlägt. Klar, man sieht viel von den politischen Unruhen und merkt, dass das die Charaktere mitnimmt. Doch ansonsten bekommt man wenig von der Wirkung der Stadt mit, da man sich mit den Figuren fast nur zwischen der Wohnung und der Kneipe bewegt, unterbrochen von Ausflügen in den Wald. Und diese Enge steigert sich. In der ersten Phase, wo Franz Bieberkopf mi Lina zusammen ist, bekommt man noch mehr Stadtleben mit. Da versucht er sich ja als Straßenhändler.
A: Man bekommt ja ein bisschen was davon mit, wie mörderisch der Verkehr in der Stadt war. Also alle, die schon ein Auto hatten, nutzen das radikal aus. Und Kutschen und so gibt es ja auch noch. Auf jeden Fall ist das immer sehr aufwendig und riskant, auf die andere Straßenseite zu gelangen. Aber ansonsten hat man fast mehr von diesen Transitmomenten, wenn er von der Stadt aufs Land geht, oder vom Land in die Stadt. Sonst sind das halt so dunkle Kaschemmen und Rückzugsorte, die sind vielleicht genuin städtisch, obwohl es dunkle Stuben ja auch auf dem Land gibt.
J: Ja, die Kneipe könnte auch auf dem Dorf sein, vor allem, weil sich da alle kennen. Die Stadt ist hier nicht der Ort der Begegnung mit Fremden, wie in dem Gedicht Augen der Großstadt (Tucholsky, D 1930), wo es heißt: „da zeigt die Stadt / die asphaltglatt / im Menschentrichter / Millionen Gesichter“. Bei der Emilia hat man vielleicht schon so ein bisschen diese typische Geschichte des Mädchens vom Lande, das in die Stadt gerät und dort ausgebeutet wird. Aber den Übergang bekommt man nicht mit. Auch sie sieht man nur in den vertrauten, recht dörflichen Strukturen des Alexanderplatzes.
A: Was ich aber auch noch interessant finde: Die Geschichten der Emilia und der Eva werden gar nicht als Ausbeutungsgeschichte erzählt, zumal die beiden auch gar keine Zuhälter haben, sondern ziemlich selbstbestimmt Freier annehmen und damit Geld verdienen. Das wird schon so als genuiner Job beschrieben, dem man in der Stadt als Frau nachgehen kann. Bei der Ida hingegen kommt das schon eher wie ein Ausbeutungsverhältnis rüber.
J: Ja, da gibt es am Ende ja auch diese Vision, wo Franz Bieberkopf sich ins Totenreich fantasiert, und Ida hat noch ihre Verletzungen und muss ihn trotzdem immer noch bedienen – ihm Kaffee bringen -, obwohl sie vor Schmerzen kaum laufen kann.
A: Stimmt, die Ausbeutung scheint gerade im Häuslichen zu liegen. Bei den Sexarbeiterinnen die rausgehen, hat man eher das Gefühl, dass die etwas freier mit allem umgehen als die Frauen, die sich auf dieses Häusliche einlassen, wie die ganzen Partnerinnen, die Franz von Reinhold übernimmt.
J: Aber bei Emilia gibt es auch immer wieder diese Szenen – ich glaube, die gibt es mit fast allen Frauen, mit denen Franz zusammen ist –, wo er am Frühstückstisch sitzt und sie auf dem Boden kniend scheuert.
A: Aber auch das spielt dann ja letztlich wieder im Häuslichen. Die Rollen wechseln immer wieder. Emilia, und auch Ida, waren ja eigentlich die, die das Geld verdienen. Trotzdem entkommen sie der traditionellen Rolle nicht. Bei der Cilly ist es ja ähnlich, sie ist Sängerin im Nachtclub und hat damit auch eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit. Doch in der häuslichen Rolle ist sie auch eingefahren in den Strukturen. Vom Film her wird aber jetzt nicht groß unterschieden, ob jemand Sexarbeiterin ist oder Sängerin oder etwas anderes. Es gibt aus dieser Zeit auch Filme, wie zum Beispiel Die freudlose Gasse (D 1925) von Georg Wilhelm Pabst, wo die Wirtschaftskrise schon im vollen Gang ist und die Armut grassiert. Da wird auch so ein Häuserblock gezeigt, wo sich jeder selbst ausbeutet, um irgendwie über die Runden zu kommen. Sexarbeit wird dort viel stärker mit so einem Ausbeutungsmerkmal verbunden. Und hier, zumindest bei der Fassbinder-Adaption, ist das nicht so deutlich. Das ist einfach etwas, was Frauen in der Stadt machen können, um eine unabhängige Arbeit zu haben.
J: Dennoch hat man auch hier irgendwie beide Bilder. Es gibt ja auch diese Gasse mit den vielen Bordellen, wo so ein merkwürdiger Typ Franz Bieberkopf immer wieder erzählt: „Das ist die Hure von Babylon. Sie trinkt das Blut der Heiligen.“ Bis in das imaginierte Totenreich hinein verfolgt Franz das.
A: Ja, diese Gasse ist irre. Im Epilog wirkt das fast so, als wäre sie immer schon eine Halluzination gewesen, oder ein absurdes Theater, das irgendwie hereinplatzt. Sie schient gar nicht ein realer Teil dieser Welt zu sein.
J: Das hätte ich auch so gelesen, dass diese Gasse nicht wirklich existiert. Sie passt gar nicht in die Stadt hinein. Diese ganze Vision des Totenreiches und auch die Gasse dienen Franz ja als Schuldabwehr oder Schuldumkehr. Angeblich trinkt die Hure – also Ida oder Emilia – das Blut eines Heiligen. Doch als dieses Motiv im Epilog zum letzten Mal zitiert wird, steht Emilia inmitten von Blut, das offensichtlich ihr eigenes ist.
A: Gleichzeitig scheint diese Rede von der Hure von Babylon aber auch etwas Anziehendes oder Erregendes sein zu sollen. Der Typ versucht Franz ja auch etwas damit zu verkaufen. Er vermittelt das Bild einer Frau, die es so wahrscheinlich gar nicht wirklich gibt.
J: Es ist aber auch ein Bild, das Franz Bieberkopf in diese Passivität hineinführt. Im Epilog sagt er ja auch: „Niemandem wurde so übel mitgespielt wie mir“. Das passt überhaupt nicht zu dem, was eigentlich passiert. Er ist ja enorm aggressiv und trifft lauter falsche Entscheidungen.
A: Das ist echt interessant. Im Grunde ist er auch jemand, der keine Entscheidungen treffen, sondern sich zurückziehen will. Das wechselt immer wieder. Er hat jedenfalls große Schwierigkeiten damit, zu irgendeiner klaren Haltung zu kommen. Zum Beispiel geht es ihm extrem schwer von der Hand, dass es vielleicht keine so gute Idee ist, von Reinhold diese Frauen zu übernehmen und sie dann wieder abzustoßen.
J: Ja, letztlich hört er auch nur damit auf, weil Meck ihm sagt, dass das überhaupt nicht geht.
A: Immer wieder, wenn ihm irgendwer etwas zuflüstert, nimmt er das als neue Haltung an. Selbst zu einer Haltung zu gelangen, kann er gar nicht.
J: Als wir die erste Folge geschaut haben, meintest du ja auch, dass Franz Bieberkopf auf eine besondere Art und Weise einfältig ist.
A: Ja, er ist einfältig, irgendwie naiv, aber trotzdem halt nicht einfach gestrickt, weil er diese komplexen gedanklichen Saltos vollführt, durch die er zu Entscheidungen gelangt oder rechtfertigt, warum er so oder so entschieden hat. Man merkt, dass da schon einiges in ihm arbeitet.
J: Diese Saltos sind philosophisch oder wenigstens pseudo-philosophisch, irgendwie auch tiefgängig, aber sie haben selten wirklich einen Bezug zu dem, was eigentlich vor sich geht. Er verliert sich komplett in diesen Gedankengängen, die vielleicht für jemanden spannend wären, der ein Buch mit Aphorismen schreiben möchte, aber die ihm beim Handeln überhaupt nicht helfen oder dieses sogar behindern.
A: Das ist auch schon irgendwie modern mit den ganzen Verschwörungstheorien und Leuten, die gerne glauben wollen, dass gewisse politische Führer sie irgendwo hinbringen, wo sie hinwollen.
J: Kennzeichnend für Franz Bieberkopf ist dabei eben seine extreme Verantwortungslosigkeit. Er hat Ida erschlagen, er hat beinah Emilia erschlagen, aber er hat kein Schuldempfinden und er erhält auf seine Taten auch keine Resonanz von seinem Umfeld. Der Staat als Gewaltmonopol im Hintergrund bestraft ihn, doch sein soziales Umfeld – von seiner Zimmerwirtin bis hin zur Schwester der Ermordeten – behandelt die Tat nicht als ein ungeheuerliches Verbrechen, sondern als etwas letztlich Unbedeutendes.
A: Das hängt vermutlich auch miteinander zusammen: Einerseits weigert sich Franz Bieberkopf, ein verantwortungsbewusstes Subjekt zu sein, andererseits verlangt das aber auch keiner von ihm.
J: Und die Zimmerwirtin wirkt, wenn man das politisch deutet, halt wie die typische Mitläuferin. Man kann sich vorstellen, dass sie, wenn 1932 dann die SA oder die SS durch die Straßen marschiert, auch einfach da steht und denkt: “Ist jetzt nicht so schön irgendwie, aber so ist es halt”.
A: Ja, da ist so eine total wackelnde Resonanz auf alles. Alles prallt letztlich ab und bestärkt die Figuren nur in ihren Opferrollen. Das ist im Grunde auch die Art und Weise, wie Bieberkopf auf seine sehr passive Art, mit der er meistens nur indirekt handelt, die Menschen um ihn herum mit ins Unglück stürzt. Der Herbert ist der Einzige, der ab und zu mal sagt: „Du hast die Ida doch umgebracht. Pass auf, dass das nicht wieder passiert.“ Er hat als Einziger so ein bisschen Vernunft. Und auch eine gesunde Distanz.
J: Und gerade von der Eva kommt immer nur: „Das wolltest du ja gar nicht, es ist einfach passiert.“ Diese Spiegelung der eigenen Schuldabwehr sorgt mit dafür, dass niemals ein Prozess losgetreten wird, durch den er Verantwortung übernehmen muss.
A: Wie würdest du das dann am Ende sehen in dieser Vision, die er in der Psychiatrie hat? Würdest du das als eine Auflösung oder als eine Verschlimmerung dieses Zustandes beschreiben?
J: Weiß ich nicht, sehr schwierig.
A: Man kann sehen, dass ihn das jetzt irgendwie tatsächlich quält, dass er all diese Dinge verursacht hat. Man sieht schon, dass er nicht mehr davor weglaufen kann. Aber was dann letztendlich passiert mit ihm, wenn er wieder rauskommt aus diesem Koma oder aus dieser Paralyse, das ist ja schon sehr ambivalent.
J: Diese Vision endet ja damit, dass er imaginiert, als Jesus ans Kreuz geschlagen zu werden. Und einmal sieht er Reinhold mit einer Dornenkrone. Das ist wieder diese komplette Opferhaltung.
A: Das ist ja letztendlich auch seine Wahnvorstellung, sein Delirium. Diese Engel reden schon immer so, als wollten sie ihn aufwachen lassen, ihn von einem Kind zu einem Erwachsenen machen.
J: Dennoch wirkt es am Ende, als hätte er die gleiche ignorante Haltung wie vorher und würde sehenden Auges in die nächste Katastrophe rennen. Er trifft ja Reinhold vor Gericht, und hilft ihm dort wieder mit der Schuldabwehr, indem er dafür sorgt, dass Reinhold nur für Totschlag im Affekt verurteilt wird, obwohl er mindestens ahnt, das Reinhold Emilia ganz bewusst in den Wald gelockt hat.
A: Die Beziehung mit Reinhold ist auch nochmal eine ganz eigene Pathologie. Im Epilog wird ja auch klarer, was in den anderen Folgen nur so durchscheint, nämlich dass es da so eine Hassliebe zwischen den beiden gibt. Die Frage ist, ob Franz Bieberkopf das bewusst wird oder ob er das weiterhin verdrängen kann.
J: Das ist halt so ein Begehren zwischen den beiden. Und vielleicht wollen die beiden das über die Frauen auch nur austragen, weil sie sich das in dieser Gesellschaft einfach nicht eingestehen dürfen. Gleichzeitig zeigt diese Vision vom Boxkampf, dass Reinhold aber auch die ausgelagerte Schuld von Franz Bieberkopf ist. Es ist vermutlich kein Zufall, dass Reinhold verursacht, dass Franz der rechte Arm abgefahren wird. Denn das ist ja der Arm, mit dem er Ida erschlagen hat. Reinhold ist somit zugleich die Personifizierung der Schuld und das Objekt der Begierde.
A: Und dann gibt es da ja auch noch die Freundschaft mit Meck, die ebenfalls durch die Beziehung zu Reinhold in Mitleidenschaft gezogen wird. Meck wird ja mehr als der noch halbwegs anständige, ehrenhafte Gangster gezeichnet. Zumindest überwältigt ihn irgendwann sein Gewissen und er geht zur Polizei, damit Emilas Leiche gefunden werden kann. Er übernimmt Verantwortung, im Unterschied zu Biberkopf.
J: Die Beziehung zu Lina schmeißt Biberkopf ja auch sofort weg, weil er nicht eingestehen konnte, dass es falsch war, sich auf eine Affäre mit dieser Witwe einzulassen. Dabei war Lina diejenige, der er geschworen hat, anständig und ehrlich zu bleiben, und diese Beziehung wäre vielleicht wirklich eine Möglichkeit dazu gewesen. Jedenfalls stand Lina ganz anders im Leben als seine späteren Partnerinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lina sich auf Leute wie Reinhold überhaupt eingelassen hätte. Mit Lina wäre vielleicht ein Ausweg aus dem Milieu der Kleinkriminellen möglich gewesen.
A: Das ist dann vielleicht doch etwas, was dann die Stadt stark hervorhebt, dass da in dieser Armut und drohenden Totalkatastrophe alle noch versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, meistens mit illegalen Vorhaben. Es ist ja auch absurd, dass gerade die Anarchisten den Wert ehrlicher Arbeit predigen.
J: So ein bisschen hatte ich ohnehin das Gefühl, dass die Anarchisten nicht wirklich glauben, was sie predigen. Im Grunde sind das einfach Sozialisten.
A: Also ein bisschen geht es einfach darum, dass man überhaupt als Mensch eine Haltung entwickeln muss. Und dass man, wenn man das nicht tut, dem Untergang geweiht ist. Das ist natürlich dann auch schon eine Allegorie auf die gesamte Gesellschaft.
J: Ja, und Fassbinder wusste ja – anders als Döblin beim Schreiben des Buches –, was nach 1928 passiert. Aber er hält sich ziemlich zurück. Nur im Epilog wird das expliziter.
A: Und der Biberkopf läuft dem quasi entgegen. Er wartet eigentlich nur darauf, dass ihn der nächste verführt
J: Im Epilog deutet Fassbinder ja schon stark an, dass er am Ende bei den Nazis landet. Er singt da wieder Die Wacht am Rhein (Schneckenburger, D 1871).
A: Ich habe dabei nicht mal das Gefühl, dass der Film sagt, man müsse auf jeden Fall zu diesem oder jenem Werturteil kommen. Aber er kritisiert diese Grundhaltung, dass man sich einfach für alles begeistern lässt. Er kritisiert also die Begeisterung für diese Einfältigkeit, dieses Kinderstaunen, womit man sich in alles reindenken und alles akzeptieren und irgendwie nachplappern kann. Und das hat man im Film von zwei Seiten. Einmal bei Franz, der das dauernd macht, dann aber auch bei den Leuten, die sich auf ihn einlassen, gerade weil er so ist.
J: Und dem Film gelingt es, diese Haltung als Gefahr darzustellen, obwohl die Morde, die Biberkopf und Reinhold begehen, keine politischen Morde sind. Sicher kann man sagen, dass die Gesellschaft von Strukturen durchzogen ist, die solche Morde begünstigen, aber das ist den beiden überhaupt nicht bewusst.
A: Ja, die Morde sind eher dadurch bedingt, dass Franz – und vermutlich auch Reinhold – keine Verbindung zu sich selbst zu seinen Gefühlen hat. Und das ist ja schon auch wieder irgendwie sehr zeitgemäß, diese Idee, dass man quasi nur seinen Gefühlen folgt, ohne zu wissen, was diese Gefühle überhaupt eigentlich meinen oder wo die herkommen.
J: Aber der Film zeigt das, ohne eine Origin Story zu erzählen, wie man es vermutlich heute machen würde. Da ist keinerlei Erzählung nach dem Motto: Franz Biberkopf hatte so eine schlimme Kindheit, sein Vater hat ihn nie beachtet, seine Mutter ist abgehauen. Wir sind halt sehr geprägt von so Büchern wie Das Kind in dir muss Heimat finden (Stahl, D 2015). Sicher kann man sich denken, dass eine Kindheit im Ersten Weltkrieg nicht toll war. Dennoch ist die Idee, dass die Probleme des Erwachsenen sich vor allem aus der Kindheit herleiten, ein sehr gegenwärtiges Interpretationsschema.
A: Ja, es geht schon mehr um die Armut als ein verbindenes Element.
J: Das ist aber vermutlich auch ein Phänomen dieser Krisenzeit, dass sich die Armut so stark bis in die Innenstädte hineinzieht. Gleichzeitig gab es damals halt auch eine große Landflucht, die viel Armut in die Städte brachte.
A: Es ist keine sehr rosige, glamouröse Darstellung von Berlin. Das ist in heutigen Filmen oder Serien, die zu der Zeit spielen, oft anders, und in Stummfilmen der damaligen Zeit ebenso, z.B. in Menschen am Sonntag (Siodmak; Ulmer et. al, D 1930). Da geht es auch um arme Menschen, dennoch haftet dem Ganzen schon etwas Utopisches an. Man hat schon das Gefühl, dass die Menschen hart arbeiten müssen, trotzdem ist da so eine Aufbruchsstimmung und die schönen Seiten der Stadt werden auch gezeigt. Und in neueren Produktionen wird oft der Glamour betont. Die wilden Zwanziger, da war die Welt noch in Ordnung und alles war irgendwie genderfluide und Frauen hatten neue Mode und waren selbstständiger. Das wird da schon stark idealisiert.
J: Hier hingegen ist alles sehr düster und es gibt keine Fluchtmöglichkeiten. Selbst scheinbar idyllische Orte wie Freienwalde wirken nicht wie Gegenorte zur Stadt.
A: Der einzige Ort, der wirklich von der Stadt getrennt zu sein scheint, ist das Gefängnis, also Tegel. Dieser Ort ermöglicht eine Art von Entkommen, auch wenn es natürlich kein schöner Ort ist. Das Gefängnis ist eben auch einfach dahingehend anders, dass das eigene Leben von außen geregelt wird.
J: Das spielt Franz Bieberkopfs Verantwortungslosigkeit sehr in die Karten. Deshalb ist seine Rehabilitation, die das Gefängnis bewirken sollte, am Ende wohl auch gescheitert. Mit der Psychiatrie wiederholt sich das dann ja auch quasi nochmal.
A: Ja genau, da konnte man sich auch wieder fragen, ob dieses Entlassen-Werden aus der Psychiatrie für ihn eigentlich ein Vorteil ist, oder wie beim ersten Mal eine Art von Strafe? Denn es wird ja schon angedeutet, dass er sich nach 1932 zu noch schlimmeren Verbrechen wird hinreißen lassen.
J: Ja, er wird wohl jemand, der dann sagt: „Ich habe doch nur Befehle befolgt. Ich habe doch gar nichts gemacht.“
A: So ein bisschen ist Berlin Alexanderplatz ebenso wie Spalovac mrtvol (Herz, ČSR 1969) ein Film darüber, was für eine Art von Charakter man für ein totalitäres System braucht. Franz Bieberkopf ist schon anders als der Kopfkringel, aber ein paar Parallelen zwischen den beiden bestehen schon, vor allem dahingehend, dass beide für alles super empfänglich sind, da sie keine eigene Haltung haben.
J: Ja, wobei Kopfrkringel sich in so eine Parallelwelt hineinfantasiert, während Bieberkopf eher jemand ist, durch den hindurch andere wirken können.
A: Ja, vielleicht ist in diesem Sinne dann doch auch die Großstadt wieder relevant, da die Stadt ein Ort ist, wo sich alles verstärkt und alles verstärkt wird. Die Prozesse laufen da einfach wesentlich schneller ab, und du hast wesentlich mehr Menschen, die sich selbst alle gegenseitig verstärken können. Franz Bieberkopf ist dabei wie so eine Art Signalmast.
J: Genau, und im Buch hat man natürlich noch nicht die Perspektive auf die Zeit nach 1928, aber trotzdem merkt man auch da, wie die Agenden all der unterschiedlichen politischen Gruppen auch im Inneren von Bieberkopf um die Vorherrschaft kämpfen. Das erinnert schon ein bisschen an die Situation von heute, mit den digitalen Resonanzräumen wie X oder TikTok. Darin wäre jemand wie Bieberkopf vermutlich völlig verloren. Diese Szene in der Kneipe, wo Bieberkopf und seine ehemaligen kommunistischen Freunde sich im Lieder-Singen überbieten wollen, erinnert ja schon an eine Diskussion auf X, wo die Leute nur im immer aggressiveren Ton die immer gleichen Schlagworte posten.
A: Und auch in den 1920er Jahren hatten die Menschen vermutlich das Gefühl, dass die Medienlandschaft um sie herum quasi explodiert und die Ereignisse sich überschlagen.