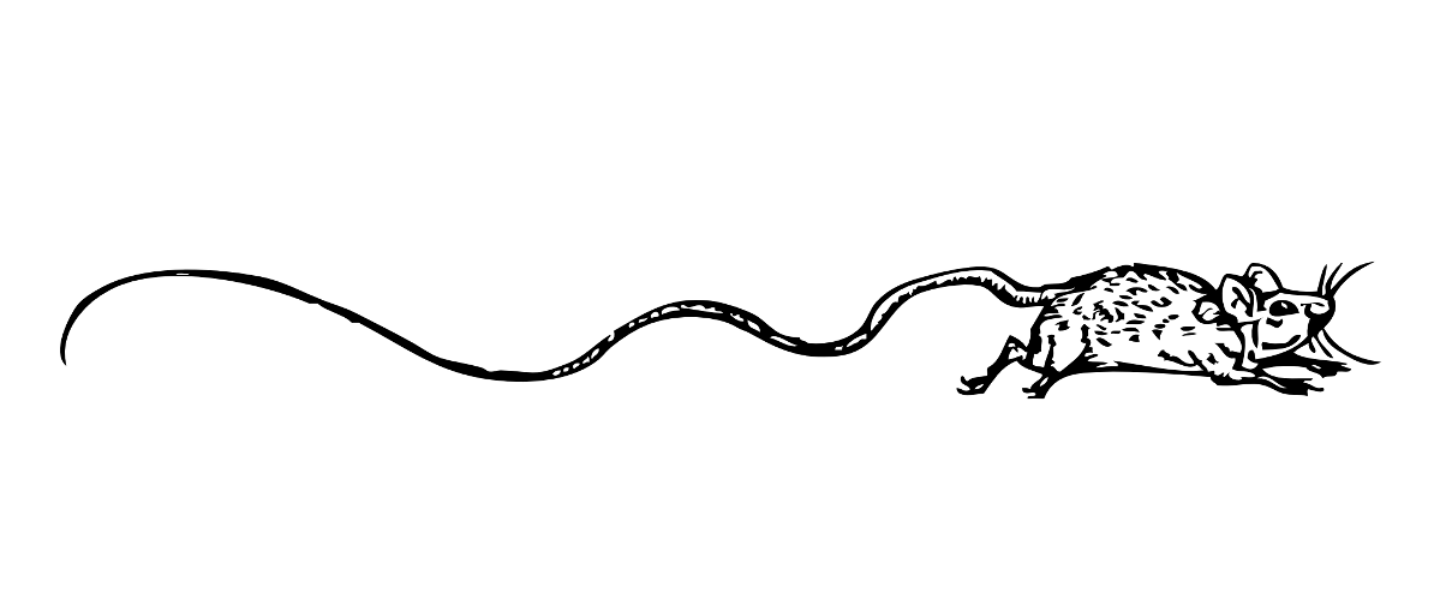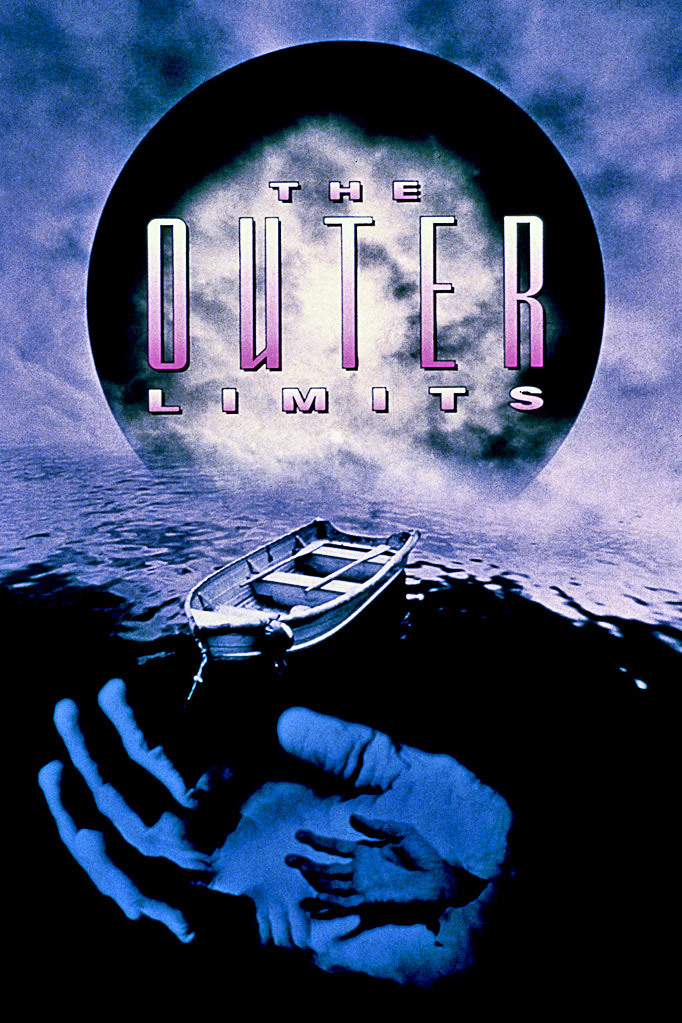
Darum geht’s: Norman freut sich auf den ersten Jahrestag mit seiner Frau Ady, die er über seinen Freund Dennis kennengerlernt hat. Doch warum kann er plötzlich Adys Geschmack und Geruch nicht mehr ertragen? Und warum verfällt Dennis, der mit Adys Freundin Barbara gerade ebenfalls den ersten Jahrestag gefeiert hat, plötzlich dem Wahnsinn? Norman muss schließlich erkennen, dass er und sein Freund mit zwei auf der Erde gestrandeten Außerirdischen zusammen waren, die durch eine Art Wahrnehmungsfilter die Illusion erzeugen können, menschlich zu sein.
Achtung: Schwere Spoiler!
A: Also jenseits von der Handlung der Folge, durch die Art der Narration, ist eigentlich klar, dass es einfach eine Analogie auf Partnerschaften ist, nicht? Also diese Idee, dass man sich nach dem ersten Verliebtsein irgendwann voneinander entfremdet. Das ist schon interessant, dass das komplett aus dieser weiblichen Perspektive erzählt wird, also dieses Gefühl, abgestoßen zu werden oder irgendwie selbst abstoßend zu sein.
J: Ich finde es auf jeden Fall interessant, wie es zu der Entfremdung kommt. Es geht über die basalen Sinne, Geruch und Geschmack. Also über die Sinne, die am wenigsten konzeptuell arbeiten. Augen und Ohren bleiben viel länger in der Verdrängung, sie nehmen die Welt viel länger so wahr, als wäre alles in Ordnung. Und dagegen steht dieses ganz basale Gefühl des Ekels, das zum Vorschein bringt, dass etwas nicht stimmt in dieser Partnerschaft.
A: Aber eigentlich doch eher deshalb, weil der Geschmack immer so als feinerer Sinn beschrieben wird. Der Geschmackssinn eben. Die Sinne hingegen, die abgestumpfter sind, brauchen viel länger, um zu erkennen, was sie eigentlich wahrnehmen.
J: Hängt das mit damit zusammen, wie konzeptuell die Sinne arbeiten, also dass die Sinne, die stark mit dem Intellekt verbunden sind und sofort Konzepte über die ursprünglichen Eindrücke legen, sich schwerer damit tun, das „Alienhafte“ wahrzunehmen, weil sich Konzept und Idealbild immer vor die eigentliche Wahrnehmung stellen? Das ist bei Geruch und Geschmack viel weniger möglich. Wenn etwas bitter schmeckt oder ekelig riecht, ist das ein sehr primitives, ursprüngliches Gefühl, während im Konzept von Schönheit viel kulturell hineingelegt wird und man das Sehen dadurch manipulieren kann.
A: Andererseits ist aber auch gerade der Geschmack so intellektuell konzeptualisiert worden, zum Beispiel bei Bourdieu.
J: Ja, gut, das stimmt.
A: Ich meine, dass man immer von feineren Abstufungen von Geschmack spricht und diese Frauen sich den Männern so präsentieren, dass sie immer das volle Paket bringen, die totale sinnliche Überwältigung. Auch deshalb fällt es Norman und Dennis überhaupt so stark auf, dass sich diese Sinneswahrnehmungen ändern. Vorher sagen sie ja immer in einer extremen Verstärkung: „Oh, du schmeckst so gut, du riechst so gut, du siehst so toll aus, du fühlst dich so gut an.“ Da ist schon die ganze Zeit über eine starke Awareness, dass man das Maximale in dem Anderen hat. Und weil das so gesteigert ist in dieser Beziehung, fällt es auch eher auf, wenn es nicht mehr ganz so genau passt. Da fallen dann kleine Abweichungen einfach schneller auf, als wenn das Ganze auf ein etwas niedrigerem Niveau gestartet wäre.
J: Ja, das Essen, das Sinnliche scheint ehe eine große Rolle zu spielen. Die essen und kochen ja die ganze Zeit.
A: Ich habe das aber etwas allgemeiner gedacht, also einfach, dass das, woran sie das „Alienhafte“ erkennen, letztendlich Geschmack in einem konzeptuellen Sinne ist. Es ist ja irgendwie auch so, dass alles, was visuell ist, oftmals gar nicht so sehr unter Geschmack gefasst wird. Also darunter zählt man ja mehr so Sachen wie Essen oder so, wo viel diskutiert wird, wie irgendetwas schmeckt. Vielleicht ist das auch das, was du meintest, dass da jeder sofort mitdiskutieren kann, weil es quasi intuitiv passiert und man da nicht so groß drüber nachdenkt. Ein Gemälde zu beurteilen und einen Geschmack dazu zu entwickeln, ob ein Gemälde schön ist oder nicht, ist halt viel weniger intuitiv und viel stärker durch Nachdenken oder intellektuelle Leistung bedingt.
J: Ja, genau das meine ich. Beim Sehen sind wir viel stärker mit den intellektuellen Konzepten verbunden.
A: Da könnte man natürlich auch einwenden, dass das auch etwas mit Erfahrungen zu tun hat.
J: Klar, das Gehirn versucht, Sinn in seine Wahrnehmungen zu bringen und nutzt dafür auch seine Erfahrungen. Und gerade wenn es etwas sieht, was es nicht mit Sinn füllen kann, dann überschreibt es das mit vertrauten Konzepten oder verdrängt diese Wahrnehmung. Also, am Anfang haben wir ja dieses Gespräch, wo Norman sagt: „Ich werde dich immer schön finden, auch wenn du deine Haare und deine Zähne und alles verlierst.“ Am Ende – in ihrer wahren Gestalt – hat Ady dann wirklich keine Haare und keine Zähne. Das findet er dann aber offensichtlich nicht so schön.
A: Ja, das ist sehr stark, das erinnert mich auch an H.P. Lovecraft, diese Idee: Das ist etwas, das einen völlig in den Wahnsinn treibt, wenn man es sieht. Also im Grunde ist das ja auch eine totale Überhöhung des Sehsinns. Das finde ich zum Beispiel so interessant in Geschichten wie Pickman´s Model (USA 1927), wo der Protagonist einfach durch visuelle Anschauungen wahnsinnig wird. Das ist eine Idee, die wir heute gar nicht mehr so ernst nehmen als etwas, das uns verrückt machen kann.
J: Stimmt, das ist eine interessante Idee, dass man wirklich durch etwas Äußeres so überwältigt wird in der Wahrnehmung, dass das ganze Weltgefüge zusammenbricht. Ich hätte halt immer eher diese Vorstellung, das von innen her zu interpretieren, also, dass der Wahnsinn von innen kommt.
A: Klar, das hätte ja auch leicht alles nur in Normans Kopf sein können. Gerade bei solchen Sachen wie Gerüchen und Geschmack, da fragt man sich schon, ob das nicht einfach Einbildung ist. Aber am Ende ist es schon ziemlich klar, dass die Überwältigung von außen kommt.
J: Das straft natürlich auch diese ganzen Kalendersprüche Lügen. Ich meine so Sprüche wie: „Es kommt nur auf die inneren Werte an“.
A: Ja, das sind quatschige Sprüche, die völlig ausblenden, was für ein sinnliches Wesen der Mensch ist. Natürlich liebt man sich nicht nur auf einer rein intellektuellen Ebene. Natürlich ist man ein sinnliches Wesen.
J: Aber wie ist das aus Adys Perspektive? Für ihre Liebe scheint die Sinnlichkeit wirklich weniger entscheidend zu sein. Also, wenn man sich vorstellt, sie wäre ein Alien, dann müsste sie ja im Prinzip die Menschen genauso hässlich und abstoßend finden, wie die Menschen sie. Aber sie kann das viel besser ausblenden, sich auf die Beziehung einlassen und dann wirklich auf – weiß ich nicht – “innere Werte” schauen.
A: Ja, wenn es wirklich so ist, wie sie es andeutet, dass sie und ihre Barbara von einem anderen Planeten kommen und auf der Erde gestrandet sind, dann muss unser Aussehen deren Schönheitsidealen und deren Idealen von einem guten Geruch genauso widersprechen. Aber die beiden haben halt auch gar keine andere Wahl, da sie die einzigen auf diesem Planeten sind, die so sind, wie sie sind. Sie haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als das auszuhalten und zu akzeptieren und das Sinnliche für sich selbst auszublenden.
J: Genau, sie sind in so einer Situation, wo sie kaum eine andere Wahl haben. Aber sie treffen dann halt die ganze Zeit auf diese total sinnesbezogenen Männer. Ich weiß nicht, ob sie auch an Frauen interessiert sind. Wahrscheinlich nicht, sonst könnten sie ja auch zusammen eine Partnerschaft eingehen.
A: Aus irgendwelchen Gründen scheinen sie jedenfalls füreinander nicht als Partner in Frage zu kommen, und deshalb docken sie bei den Menschen an.
J: Doch obwohl menschliche Partner für sie vemutlich auch nur eine “Notlösung” sind, liegt den beiden sehr viel daran, die Anerkennung von den Menschen zu bekommen, dass sie schön sind. Sie haben ja das Talent, diese Illusion zu erzeugen, dass sie sinnlich genau das bieten, was alle haben möchten. Das können sie anbieten und sie bekommen die entsprechenden Reaktionen darauf. Aber die Illusion muss ja eigentlich immer etwas zeigen, was sie selbst gar nicht attraktiv finden. Das muss sich merkwürdig anfühlen, dass man die ersehnte Anerkennung für etwas erhält, was man selbst eher abstoßend findet.
A: Das ist vor allem interessant, wenn du es auf das wirkliche Leben beziehst. Also, diese Idee, dass man sich im Grunde von sich selbst entfremdet, indem man eine Rolle spielt für jemand anderen, in der man gar nicht wirklich aufgeht, die einen vielleicht sogar zu jemanden macht, den man selbst vielleicht überhaupt nicht mag. Was ja nicht nur Frauen betrifft, heutzutage, aber als die Folge in den 90ern herauskam, hat man vielleicht noch mehr an Frauen gedacht als an Männer. Also, ein klassisches Beispiel wäre vielleicht die radikale Haarentfernung, diese Idee: „Ich muss ja ein komplett haarloses Wesen sein“, als Frau oder heute ja auch oft als Mann. Es darf nirgendwo ein Haar sein, da richtest du dein ganzes Leben drauf aus. Aber vielleicht findest du das selbst gar nicht schön. Und das ist ja vielleicht etwas, was man sich nicht mal selbst eingestehen kann.
J: Das ist ein gutes Beispiel. Wenn man selbst das Ideal nicht teilt, macht man die Haarentfernung vielleicht trotzdem für die Anerkennung der Umwelt. Aber die Anerkennung bekommt dadurch etwas sehr Zwiespältiges, weil sie ja dann niemals wirklich die eigene Person betreffen kann. Wie viel Befriedigung kann aus solcher Anerkennung erwachsen?
A: Man ist halt so konditioniert, dass man dennoch nach dieser Anerkennung so vampirisch giert. Bei Ady und Barbara entwickelt sich das ja zu einer Art Obsession. Alles, was sie noch wollen, ist die Anerkennung, schön zu sein.
J: Dabei habe ich mich auch gefragt, woran es liegt, dass nach einem Jahr diese Fähigkeit, eine Illusion herzustellen, immer geringer wird. Vielleicht liegt das daran, dass mit der Zeit das Bedürfnis wächst, Anerkennung für das zu bekommen, was man wirklich ist. Und dann schwindet der innere Wille, sich zu verstellen.
A: Ja, genau. Vielleicht braucht diese Fähigkeit auch einfach extrem viel Willenskraft. Ich finde aber hinsichtlich der Frage, wie die Beziehungen funktionieren, auch interessant, dass Norman und Dennis ihre Partnerinnen vor allem so sehr schätzen, weil diese alles so übererfüllen. Die beiden sind ja quasi Inbegriffe der ‘Trophy Wife’. Immer wieder kommt die Frage: „Wie habe ich diese Frau bloß verdient, die quasi alles, was ich mir jemals erträumt habe, in sich vereinigt?“ Und dann stellt sich ja auch die Frage, wie viele von diesen Dingen man wirklich möchte und wie viele einfach nur Teil eines Idealbildes sind. Da fand ich auch den Dialog mit diesem jungen Typen in seiner Firma ganz gut. Der sagt: „Die Leute denken immer, ich will nur dieses Models, und vielleicht will ich das ja auch, aber eigentlich will ich auch mehr, eigentlich will ich ja eine richtige Partnerin fürs Leben“.
J: Da ist schon diese tiefe Verunsicherung zwischen dem, was man zu wollen hat und was eine Frau idealerweise erfüllen sollte und dem, was man eigentlich selber will. Man kann das nicht mal richtig aussprechen, was eigentlich die Sachen sind, die man in einer Person sucht, bis auf diese Aspekte, die rein mit dem Geschmack zu tun haben.
A: Da frage ich mich auch, ob es überhaupt gut ist, jemanden zu haben, der alles erfüllt, was man will, denn es entwickelt sich in so einer Beziehung ja nichts. Obwohl sie in der Folge ja erst das einjährige Jubiläum feiern, fühlt sich die Beziehung von Norman und Ady schon total starr und gesetzt an. Man hat eben das Gefühl, dass die beiden tatsächlich nichts Anderes haben außer dieser sinnlichen Befriedigung, die sich schon in so alltägliche Sachen einschreibt, wie: „Ich komme nach Hause und meine schöne Frau steht in der Küche und macht mir das Essen“. Aber sonst ist da nichts Partnerschaftliches, wo man das Gefühl hat, da ist so echte Vertrautheit.
J: Ja, ich finde es sowieso komisch, dass Norman überhaupt nichts über die Vergangenheit seiner Frau zu wissen scheint. Es müsste ihm doch auffallen, dass sie gar keine Familie hat und keine Vorgeschichte.
A: Das interessiert ihn gar nicht. Er nimmt dieses Geschenk quasi an, ohne das auch nur ansatzweise zu hinterfragen. Das ist schon eine Beziehung, die nie über die Oberfläche hinweggekommen ist.
J: Und die auch gar keine Entwicklungsmöglichkeiten zu haben scheint.
A: Also, die 80er und 90er waren ja auch die Zeit, wo das so richtig losging mit der Selbstoptimierung. Da wurden dann diese Typen proklamiert, die man erfüllen kann, als Frau oder als Mann. Und dann entstand diese Idee: “Theoretisch kann das jeder erlangen, wenn man sich nur genug damit beschäftigt, sich da reinhängt und Opfer bringt.” Das ist ja heute eigentlich noch extremer geworden, aber ich glaube in den 80ern ging das schon los, vor allem in bestimmten Milieus, die ein bisschen höhergestellt waren.
J: Damals, auch hier in der Folge, dominierte aber noch die Idee: Wenn man alles an der Oberfläche perfekt hinbekommt, wird auch das Innere perfekt. Heute fängt man oft eher beim Inneren an. Da herrschen die umgekehrten Ideen: Wenn man optimiert, welche Stoffe in den Körper rein- und rauskommen, die Vitalfunktionen mit der Smartwatch überwacht und die eigenen Gedanken – Think positive! – kontrolliert, dann entsteht die äußere Schönheit quasi von innen her.
A: Und wenn Ady und Barbara diese Illusion am Ende nicht mehr aufrechterhalten können, könnte das auch heißen, dass sie einfach nicht mehr all diese Selbstoptimierungslügen weiter vollführen können.
J: Und wie er am Ende reagiert, zeigt halt auch, wie stark die Idee einer Übereinstimmung von inneren und äußeren Werten noch wirkmächtig ist, allen Kalendersprüchen zum Trotz. Also diese Idee, dass wer in unseren Augen nicht schön ist, auch irgendwie böse oder gefährlich sein muss. Anders lässt sich Normans Panik am Ende kaum erklären. Ady ist ja kein böses Wesen. Sie ist einfach nur anders. Aber er reagiert nur mit Ablehnung und Panik, überhaupt nicht mit Neugier oder mit Interesse, nicht mal mit einem Hauch von Mitleid. Sie ist dann nur noch ein Monster für ihn.
A: Ja, das ist halt diese rein sinnliche Beziehung, bei der die Sinne komplett in das Gegenteil verkehrt werden. Was dann irgendwie in den Wahnsinn führt.
J: Dass es keine sexuelle Anziehung mehr gibt, mag ja verständlich sein, das ist halt stark durch das Körperliche und Sinnliche bestimmt. Aber warum Norman dann in so eine totale Ablehnung fällt, ist eine andere Frage. Er könnte sie ja trotzdem als Person schätzen oder zumindest ein grundlegendes Interesse an ihrer Geschichte entwickeln.
A: Da greift wieder die Lovecraft’sche Idee, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie schlimm diese sinnliche Überwältigung ist. Wobei er diese Überwältigung natürlich auch selbst steigert. Wenn du in den Social Media liest, was einige Leute über Körperbehaarung erzählen, dann fällst du auch vom Glauben ab.
J: Aber Körperbehaarung hat doch jeder.
A: Hier sieht man halt, wie Abscheu und Ekel doch auch gesellschaftlich stark konstruiert sein kann. Das ist hier natürlich eine Science-Fiction-Horror-Geschichte, die die Narrative stark übersteigert und sehr grell ist, aber diese Irrationalität gibt es wirklich. Und die ist rein gesellschaftlich konstruiert. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, dass man in einigen Epochen übergewichtige Leute attraktiv fand und heute extrem dünne Menschen, oder für diese Haar-Geschichte mit all den merkwürdigen Trends, dass sowas dann tatsächlich zu Ablehnung im Sinne von Ekel führt. Das ist völlig irrational, aber es existiert.
J: Klar, das ist rein gesellschaftlich konstruiert. Wenn Menschen Haare von Natur aus ekelig fänden, hätten sie sich nie fortgepflanzt. Aber was Norman am Anfang der Folge sagt, dass die Schulter für ihn nach Leichenteilen riecht, das ist schon eher eine normale – auch biologische – Reaktion, dass man vor so einem Geruch zurückschreckt. Auf ihrem Planeten wirkt der Geruch vermutlich ganz anders, da die gesamte Biologie nach anderen Prinzipien funktioniert.
A: Auf der reinen Handlungsebene schon. Aber ich sehe das als eine Metapher, weil das so übersteigert ist, wie diese wahnsinnigen Verhältnisse da umkippen. Also diese Idee, das sind Aliens, die hat ja im englischen Sprachraum auch nochmal eine starke Doppelbedeutung, weil alles, was von außen kommt, quasi „alien“ ist. Und das hat ja auch eine lange Geschichte, dass gewisse Gruppen, die als „Fremde“ gelesen werden und auf Ablehnung stoßen, auch mit Ekel assoziiert werden. Ganz stark wird das in Dracula (Stoker, UK 1897) verhandelt, und mehr noch in dem Stummfilm, Nosferatu (Murnau, D 1922). Also diese Idee, dass dieser – ja –abstoßende „Ausländer“ kommt und „unsere“ Frauen stiehlt, was sich in rechten Diskursen ja bis heute hält.
J: Die ganze Folge lässt sich gut als eine Rassismus-Metapher lesen. Dabei zeigt sich aber auch, dass die Strategie der beiden Frauen total selbstzerstörerisch ist. Ady ist am Ende komplett verzweifelt.
A: Barbara ist hingegen – ich weiß nicht, ob sie Frieden mit ihrer Situation gemacht hat – aber auf jeden Fall geht sie in dieser zerstörerischen Rolle mehr auf. Die denkt sich: „Ja, ich genieße einfach die Zeit, wo ich diese Bewunderung kriege und danach kehre ich das in Abscheu um“.
J: Ady hingegen will wirklich Teil der Gesellschaft sein. Auf der Handlungsebene hat sie aber kaum andere Möglichkeiten als extreme Anpassung. Aber wenn man diesen Aspekt des Außerirdisch-Seins weglässt, und das Ganze als Rassismus-Parabel liest, würde man ja schon hoffen, dass es politisch bessere Wege gibt als die totale Selbstverleugnung und Überanpassung.
A: Es geht in der Folge vielleicht mehr darum, diese extremen Anpassungsleistungen überhaupt erstmal sichtbar zu machen, die Menschen leisten müssen, die nicht so gelesen werden, dass sie quasi automatisch dazugehören.
J: Dennoch legt die Narrative es ja sehr nahe, nicht Ady und Barbara, sondern Norman und Dennis als Opfer zu sehen, da diese gewissermaßen getäuscht werden und eine Beziehung eingehen, die sich letztlich als völlig unwirklich erweist.
A: Stimmt. Aus der Perspektive der Männer betrachtet trifft die Folge auch das Konzept des „Catfishing“ ganz gut, auch wenn es das damals noch gar nicht gab. Also dass jemand eine Identität aufbaut, die völlig irreal ist, aber damit übers Internet eine extrem starke, lebensverändernde Beziehung eingeht.
J: Stimmt, wie bei Catfishing-Opfern werden auch hier seine Gefühle benutzt, um ihn in eine komplette Illussion zu verstricken.
A: Und wenn Leute, die gecatfished wurden, das rausfinden, ist es auch ein ähnlicher psychologischer Schock, weil die gesamte Weltwahrnehmung erschüttert und das Realitätsgefüge völlig aufgehoben wird.
J: Man kann die Folge also in sehr unterschiedliche Richtungen lesen. Man kann Norma als Opfer betrachten, wenn man diesen Catfishing-Aspekt in den Mittelpunkt stellt, oder man kann Ady und Barbara als die eigentlichen Opfer sehen, wenn man nach den Machtstrukturen und den normsetzenden Instanzen fragt.
A: Die Folge hat wohl schon viele Diskurse vorausgeahnt, da steckt viel drin, aber alles so verklausuliert, ohne dass das an die Oberfläche geholt wird. Das finde ich interessant an solchen Geschichten, dass das nicht nur nach „socially redeeming values“ produziert wird, sondern an der Oberfläche zunächst die Medienunterhaltung steht, wo die ganzen anderen Sachen aber trotzdem drin sin.
J: Was ich dabei aber total unpassend fand, war dieser Voice-Over-Kommentar am Ende, der alles auf eine super platte Botschaft runterbricht, nach dem Motto: „Wir alle tragen Masken“.
A: Das ist echt eines der am meisten fehlgeleiteten Outros, das ich bisher in solchen Anthologie-Serien gesehen haben. Hier passiert doch viel mehr, hier wird so viel verhandelt, das kann man doch am Ende nicht einfach ausblenden und sagen: „Oh, es geht nur darum, dass wir uns alle ein bisschen was vormachen und dann merkt man vielleicht irgendwann, dass die Beziehung auf falsche Grundlagen aufgebaut ist. Dann hat man vielleicht mal eine Beziehungskrise.“
J: Ja, die Folge geht viel tiefer, weil diese ganz tiefen Gefühle von Abscheu und Ekel mit reinspielen. Das kann man kaum auf alltägliche Beziehungskrisen anwenden. Die Folge unterschätzt sich durch diesen Voice-Over-Kommentar also leider selbst ein bisschen. Irgendwo ist das aber auch sympathischer wie viele dieser modernen Serien, die in jedem Staffelfinale herausstellen müssen, wie absolut clever und tiefsinnig sie gemacht sind.