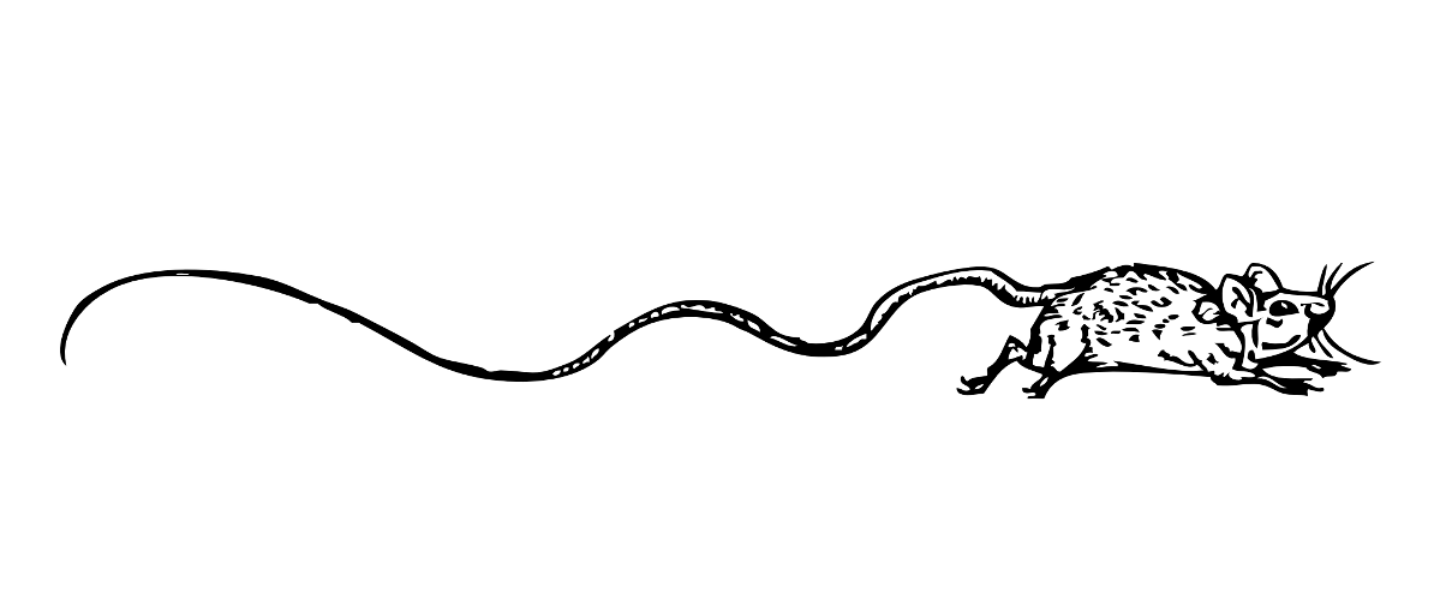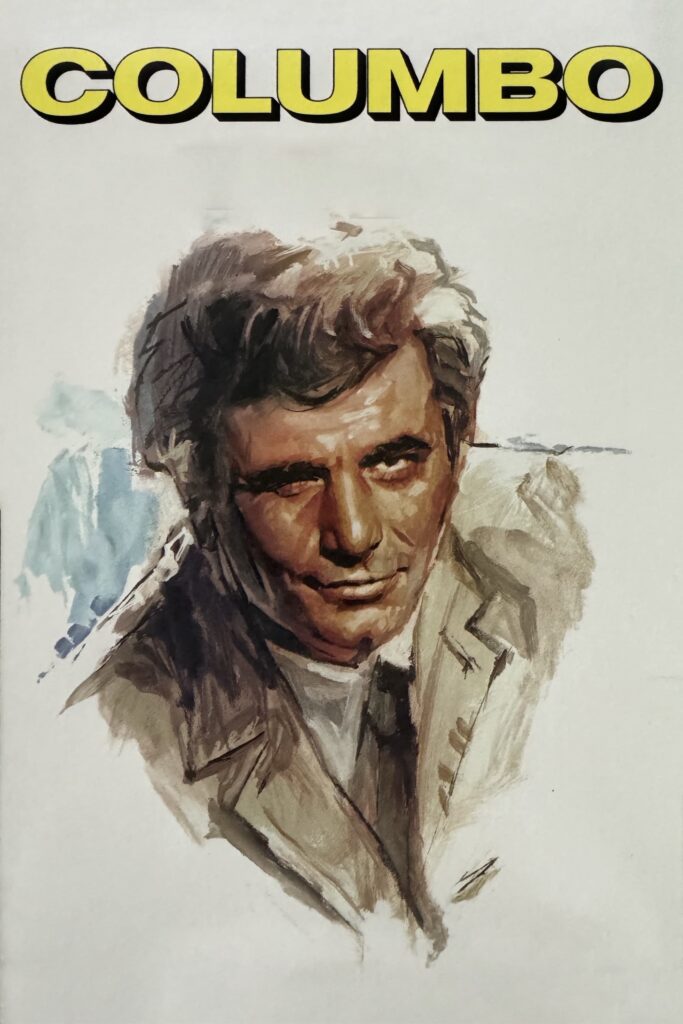
Darum geht’s: Jim Ferris, Teil eines erfolgreichen Schreibduos von Mysterien-Krimis, wird ermordet aufgefunden. Bei den Ermittlungen nimmt Columbo schon bald dessen Schreibpartner Ken Franklin ins Visier, der sich offenbar auf Kosten des zurückhaltenden, aber wesentlich talentierteren Jim Ferris den Ruf eines begnadeten Schriftstellers aufgebaut hat. Doch wie soll Columbo einen Mörder überführen, für den das Entwickeln perfekter Verbrechenspläne Teil des täglichen Broterwerbs ist?
Achtung: Schwere Spoiler!
J: Im Vergleich zu heutigen Krimis fand ich interessant, dass die Geschichte sehr schnörkellos war. Erst sieht man, wie der Mord begangen wird, wie der Täter versucht, das zu vertuschen und wie dann der Kommissar ermittelt. Es gibt wenige Nebenhandlungen drum herum, auch das Motiv des Täters wird nicht tiefer ausgeleuchtet.
A: Das Motiv findet Columbo im Laufe der Ermittlung ja heraus. Täter und Opfer haben als Autorenteam eine Versicherung füreinander abgeschlossen.
J: Ja gut, das ist so ein profanes Motiv, Geldgier. Aber das wird nicht weiter psychologisiert, dass man in die Kindheit des Täters zurückgeht oder Jahre von Konflikten und Eifersucht Revue passieren lässt. Das hat man sonst oft in Krimis – Geschichten, die Jahre zurückreichen und am Ende auch den Kommissar selbst involvieren. Dabei werden echte Morde ja vermutlich wirklich meist aus simplen Motiven heraus begangen.
A: Bei Columbo geht es vielen dieser Mörder immer sehr stark um den eigenen Status. Deswegen erhöhen die sich am Anfang der Ermittlungen auch immer so und versuchen, wenn sie können, die Ermittlungen zu manipulieren. Das ist heute in Krimis extrem selten. Da versuchen Leute immer eher, nicht aufzufallen oder den Verdacht von sich abzulenken. Sie wollen raus aus dem Rampenlicht. Und bei Columbo sind sie einfach mitten drin wie die Maden im Speck. Die denken ja, der Mord war so perfekt, so luftdicht, dass da eh keiner rankommt. Deswegen können sie eigentlich nur positiv Einfluss auf die Ermittlungen nehmen.
J: Und Columbo spielt diese Rolle des leichtgläubigen Polizisten, der nicht so richtig viel Ahnung hat.
A: Dabei stellt er immer die richtigen Fragen. Interessant finde ich auch, wie die Polizeiarbeit dargestellt wird. Das wird ja immer so wie ein Katz-und Mausspiel beschrieben. Dabei aber stark entschleunigt, wie ein Versteckspiel.
J: Das Ganze hat ein bisschen etwas von einem Spiel, wo beide Parteien auch bluffen und sich mit dem nächsten Zug Zeit lassen.
A: Und die Techniken kehren immer wieder, sind aber auch den Fällen angepasst.
J: Und dabei nervt Columbo die Leute regelrecht, passt sie überall ab und lässt es wie ein Zufall erscheinen. Die Täter sollen sich nirgendwo mehr sicher fühlen.
A: Das ist so ein psychologisches Instrument, um Leute zu verunsichern.
J: Aber er macht das mit so einer bestimmten Freundlichkeit.
A: Und die Zuschauer merken im Laufe einer Folge – ebenso wie die Täter – das Polizeiarbeit oft ganz anders funktioniert, als sie sich das vorgestellt haben. Die Täter arbeiten ja auch oft mit so einer bestimmten Idee darüber, wie die Polizei ermittelt, irgendwie hat Polizeiarbeit ja auch so ihre eigenen Mysteriengeschichten. Und dann merken sie halt, das Columbo in Wahrheit ganz anders vorgeht.
J: Er ist ja schon so ein Sherlock Holmes-Typ, aber er spielt das exakte Gegenteil. Das ist besonders auffällig im Vergleich zu dem Sherlock Holmes der neuen Serie Sherlock (Gatiss/Moffat, UK 2010-17), der immer den Drang hat, seine Brillanz zu zeigen.
A: Columbo kommt hingegen immer ganz harmlos daher, so wie jemand, den man leicht hinter das Licht führen kann. Er ist wie ein Spielbetrüger, so eine ‘Hustler’-Figur, die sich zu Beginn absichtlich schlecht stellt. Das erfordert ein hohes Maß an Fertigkeit, da man gleichzeitig auf der Lauer liegt und Strategien entwirft. Die andere Person wird total selbstsicher wird und denkt, sie hat einen bereits in der Tasche, und erst am Ende zeigt sich, wer der eigentliche Profi ist.
J: Stimmt, das ist letztlich seine Herangehensweise. Trotzdem protzt Columbo auch am Ende nie mit seinen Fähigkeiten. Er wendet sie einfach an, weil sie funktionieren.
A: Es ist schon verrückt, dass das eine Spielart ist, die man sonst selten dargestellt sieht, also einen Polizisten, der mehr wie ein brillanter Klempner oder so ist, der also seinen Job perfekt beherrscht und ausführt, aber das überhaupt nicht zur Erhöhung des eigenen Egos benutzt.
J: Und damit ist er halt auch das Gegenbild zu dem vorgeblichen Schriftsteller, der seinen Job scheinbar eigentlich gar nicht kann, aber das in extremen Maßen zu Erhöhung des Selbst nutzt. Das schließt dann auch an dieses Klischee des hochmütigen Künstlers an, der denkt, weil er etwas nachahmt, habe er voll viel Ahnung davon. Schon Platon machte sich über Dichter lustig, die denken, nur weil sie Könige darstellen, hätten sie Ahnung von den Staatsgeschäften. Und hier haben wir einen – vorgeblichen – Krimiautoren, der denkt, er könnte die echten Polizisten übertrumpfen.
A: Ja, der hält sich für eine Art Kriminologen, obwohl er anscheinend selbst sehr wenig zu den Büchern beigetragen hat.
J: Wir haben hier einen Täter, der sich selbst auf sehr hoher Ebene belügt.
A: Vielleicht ist dann sogar sein eigentliches Motiv für den Mord, das dieser Tathergang auf seiner eigenen Idee basiert.
J: Der einzige seiner Ideen für eine Kriminalgeschichte, die wirklich gut war. Sein Autorenkollege hat die aber nicht umgesetzt.
A: Und deshalb wollte er sich vielleicht beweisen, dass er auch ein brillanter Geschichtenerzähler ist und sich zugleich an seinem Partner rächen. Nicht nur dafür, dass er mit der Zusammenarbeit aufhören will, sondern auch dafür, dass er dieses Buch nie geschrieben hat.
J: Oder auch generell dafür, dass der Partner es schafft, in relativ kurzer Zeit ganze Bücher aus dem Ärmel zu schütteln, während er extrem lange braucht, um wenigstens eine wirklich gute Idee auszubrüten. Das scheint sehr an ihm zu nagen.
A: Er hat sein sehr stark überhöhtes und leicht gekränktes Ego.
J: Man hat ihm das irgendwie auch die ganze Zeit über angemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und trotzdem fallen total viele Leute auf ihn rein, der Partner selbst, die Ehefrau des Partners und die Ladenbesitzerin.
A: Diese Ladenbesitzerin fand ich aber auch extrem naiv. Die wusste sogar schon, dass er einen Mord begangen hat. Und trotzdem lässt sie sich auf ihn rein.
J: So ein bisschen sichert sie sich ab. Sie meint, alleine mit ihm auf einen Boot auf hoher See, das wäre ihr zu gefährlich.
A: Allerdings sagt sie das, während sie allein mit ihm in ihrer Wohnung ist.
J: Das ist schon merkwürdig, dass sie ihm einerseits wohl schon zutraut, einen weiteren Mord zu begehen und sich dann doch alleine mit ihm trifft.
A: Irgendwie findet sie ihn auch ziemlich attraktiv. Und sie ist einsam.
J: Sie hofft vielleicht, dass sie trotz allem zusammenkommen können. Aber auch viele andere Menschen durchschauen ihn ja nicht.
A: Das ist ja im wirklichen Leben auch so. Viele von diesen superreichen Typen, die in der Welt rumjetten, sind mittlerweile dabei, die Politik komplett für sich zu kapern oder zu kaufen, und werden dennoch von Leuten als genuin erfolgreiche Menschen verehrt.
J: Und interessant ist, dass das hier nur jemand durchschaut, der das komplette Gegenteil davon ist, der in seinen eigenen Fähigkeiten aufgeht, und überhaupt nichts erschwindeln muss.
A: Obwohl sein Partner ja auch jemand war, der so ganz in seinen schriftstellerischen Fähigkeiten aufgeht, und ihn trotzdem nicht richtig durchschaut hat.
J: Stimmt, der Partner wusste natürlich, dass er schriftstellerisch nichts beiträgt, aber er hat seine Mitarbeit wohl trotzdem geschätzt, weil er die Deals gemacht hat und mit Leuten konferiert hat. Er war vielleicht so etwas wie der Agent des anderen. Das wäre ja auch ok, wenn er nicht unbedingt selbst als der Schriftsteller hätte gelten wollen.
A: Er macht sehr lukrative und vielleicht ausbeutungsreiche Geschäfte, hat aber inhaltlich keinen Verdienst an seinem Produkt. Und das war halt auch schon in den 1970er Jahren ein starkes Thema, weil das Geschäftliche, der Aktienmarkt total explodiert sind. Die Konsumgesellschaft hat richtig Windfahrt aufgenommen. Und dann kommt die Frage hoch, was diese ganzen neureichen Leute eigentlich wirklich machen. Das war in der Gesellschaft vermutlich schon sehr prägnant.
J: Das Thema des Narzismus kam dann vermutlich auch schon in den 1970ern so langsam auf?
A: Ja, und ich glaube, die Idee, dass man mit so einem Narzismus eigentlich auf die Nase fällt, war damals noch weiter verbreitet. Es gab ja auch vorher schon Figuren wie Charles Foster Kane aus Citizen Kane (Welles, USA 1942), der auch wahnsinnig viel Macht ausspielt, aber eigentlich ist das die Biografie eines sehr tragischen Menschen, der sein eigenes Glück verspielt, Reichtum gegen seine Seele eintauscht.
J: Heute hat man oft eher diese leicht zynische Sichtweise: Sie kommen damit durch, und wenn ich das könnte, würde ich es auch tun.
A: Vielleicht war man in den 1970ern einfach noch weniger resigniert, und noch eher gewillt, dagegen anzudenken.
J: Und introvertierte Menschen waren damals scheinbar noch beliebter. Columbo ist ja sehr introvertiert, und trotzdem – oder gerade deswegen – ein Modell- und Vorzeigecharakter.
A: Und das, obwohl Columbo in einer sehr männlichen Domäne lebt. Er ist irgendwie eine interessante Mischung: Er raucht die ganze Zeit seine Zigarre und ist nicht sehr modisch, hat keinen großen Anspruch an sein Erscheinungsbild. Aber trotzdem strahlt er keinen Machismo aus.
J: Ein bisschen ist das ja auch in Sherlock so, aber da wird Sherlock Holmes als ein mega Nerd dargestellt.
A: Das ist oft so in Serien und Filmen, da wird das Introvertierte extrem überkompensiert mit so einer alpha-männlichen Kraft des Intellekts.
J: Genau, da hat man dann dieses extrem selbst-darstellerische einer deutlich männlich konnotierten Brillianz, die sich immer hervortun muss, und zwar nicht nur vor Watson, sondern vor allen Menschen, und besonders natürlich vor dem Serienpublikum.
A: Bei Columbo gibt es das auf der Seite der Mörder. Die haben meist eine Stellung in der Gesellschaft, die mit einer stark männlichen Form zusammengebracht wird. Die sind meist extrem gut gekleidet und bereits hier in der ersten Folge haben sie viele Besitztümer und Gemälde, Häuser und andere Statussymbole.
J: Das sind alles Sachen, die bei Columbo genau andersherum sind. Er hat nur ein klappriges Auto.
A: Das wird in späteren Folgen sogar noch deutlicher, da das Auto dann kaum noch fährt. Und dann hat er auch noch diesen gammeligen Trenchcoat über dem zerknautschten Jacket und ist eher schlecht oder gar nicht gekämmt. Und Peter Falk hat ja auch ein Glasauge. Das ist natürlich nochmal etwas Besonderes, weil er dadurch so ein bisschen zerstreut rüberkommt. Ich habe auch gelesen, dass Columbo während Corona in der queeren Community als eine tolle Serie entdeckt wurde.
J: Das kann ich mir gut vorstellen, da die Serie dadurch, dass Columbo nicht in diesem typischen Bild von überhöhter männlicher Brillanz und Durchsetzungsstärke aufgeht – obwohl er letztlich brillant ist – ja auch Geschlechterbilder verhandelt. Columbo droht auch weder in der ersten Folge noch in einer anderen Folge der ersten Staffel je mit seiner Waffe. Das ist für eine Krimiserie auch eher ungewöhnlich. Meist zieht der Kommissar irgendwann seine Waffe und es kommt zu wilden Verfolgungsjagden oder Ähnlichem. Hier hingegen sind die Festnahmen selbst total unspektakulär.
A: In der zweiten Folge der kommt ja sogar heraus, dass Columbo gar keine Waffe trägt. Da ist er in dieser Sicherheitsfirma und ein Mitarbeiter möchte ihn mit so einer pompösen Lichtschranke beeindrucken, also ihn da durch gehen lassen und dann angeberisch sagen: „Ich kann sehen, dass Sie eine Waffe tragen“. Er denkt zunächst , dass das Gerät kaputt sein muss, und dann ist er total perplex darüber, dass ein Polizist keine Waffe bei sich trägt. Das passt halt auch gut zu dieser Idee vom Phallischen als symbolische Macht.
J: Columbo setzt halt einfach überhaupt nicht auf symbolische Macht, sondern nur auf die faktische des staatlichen Gewaltmonopols, das er repräsentiert. Und er scheut sich auch nicht, mit anderen zusammenzuarbeiten. Er muss nicht den Helden spielen und sich persönlich beweisen.
A: Das hat aus heutiger Sicht dann auch etwas Beruhigendes, irgendwie Rückversicherndes. Man bekommt das Gefühl, dass die staatlichen Instanzen funktionieren. Das gibt es in heutigen Krimis kaum, da hat man immer dieses Vorurteil, das erst mal die Partikularinteressen, auch die der Ermittler, wichtiger sind, dass der Polizist vielleicht mehr Spaß daran hat, mit der Waffe rumzufuchteln, als etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun.
J: Heute steht meist die Angst stark im Mittelpunkt, dass die Leute in Polizei und Verwaltung mit diesen Positionen nicht gut umgehen können. Und jemanden, der einfach mal nur seinen Job macht, sieht man in heutigen Serien ohnehin selten. Das Ideal ist, dass man seine Persönlichkeit zu hundert Prozent in den Job einbringt, aber das heißt dann natürlich im Umkehrschluss auch, dass jedes private Problem auch die Ausübung des Berufes beeinflusst.
A: In den 1970er Jahren war das Misstrauen der Amerikaner gegen die eigene Regierung auch schon sehr hoch, teilweise aus sehr guten Gründen. Da hat diese Idee wahrscheinlich schon sehr wohlgetan, dass Leute rumlaufen, die einfach nur ihren Job gut machen und dann nach Hause gehen und ihr persönliches, eigenes Leben zu Hause ausleben.
J: Die Idee der Selbstverwirklichung im Beruf war damals aber vermutlich noch nicht so prominent verbreitet wie heute. In der Idee von New Work sollen Beruf und Privates ja auch ineinander übergehen. Das ist ja in Parks und Recreation (Daniels/Schur, USA 2009-15) ganz stark, obwohl die Leute da einen simplen Bürojob haben, mit dem sie Grünflächen verwalten. Dennoch wohnen sie mehr oder weniger im Büro, haben alle sozialen Kontakte im Büro, heiraten teilweise sogar im Büro, und nehmen natürlich alles total persönlich, was auf der Arbeit passiert. Und dabei hat man nicht das Gefühl, dass diese Obsession mit der Arbeit den Grünflächen selber in irgendeiner Weise dienlich ist.
A: Ich glaube, bei Parks und Recreation ist die Grundidee ja auch, dass da diese ganzen exzentrischen Individualisten in einem solchen Beruf herumlaufen, der eigentlich das Gegenteil brauchen würde, also Leute, die relativ emotionslos sind, aber die Arbeit gut machen.
J: Genau, und mit Columbo haben wir hier so jemanden, während Menschen, die sich allzu sehr mit ihrer Arbeit identifizieren, in der ersten Staffel überwiegend als Täter auftreten, die morden, um ihre Stellung, ihre Firma oder ihre berufliche Reputation zu behalten.