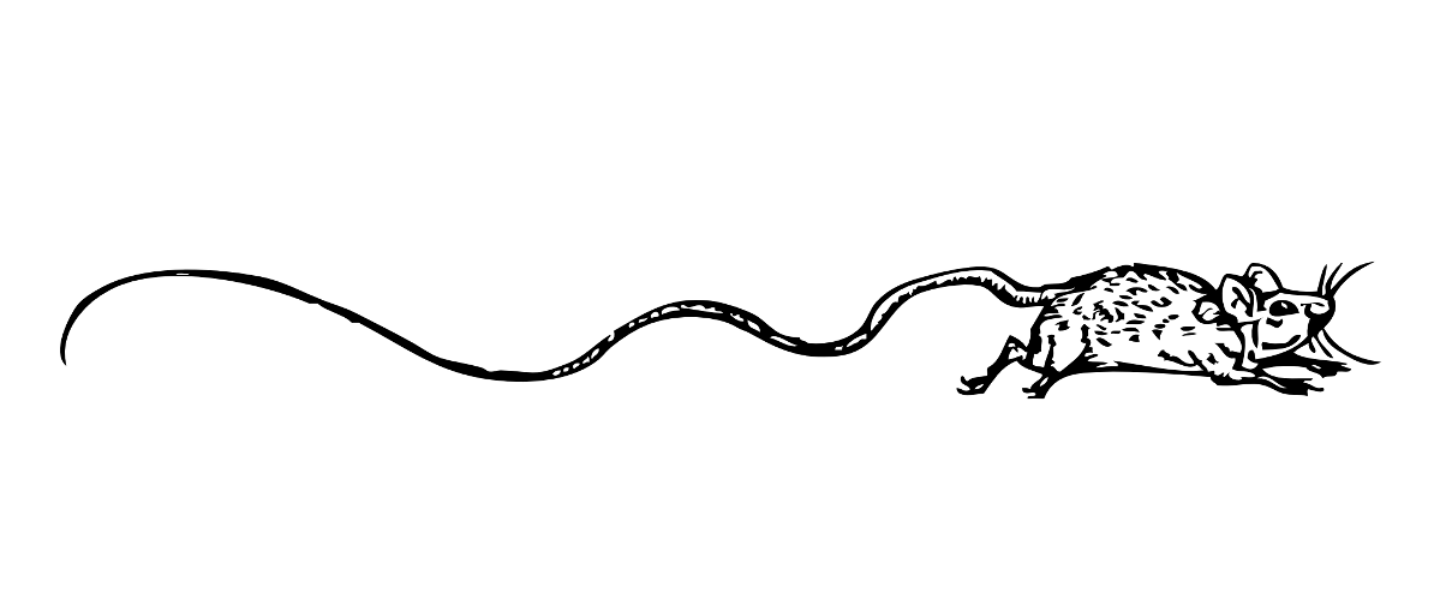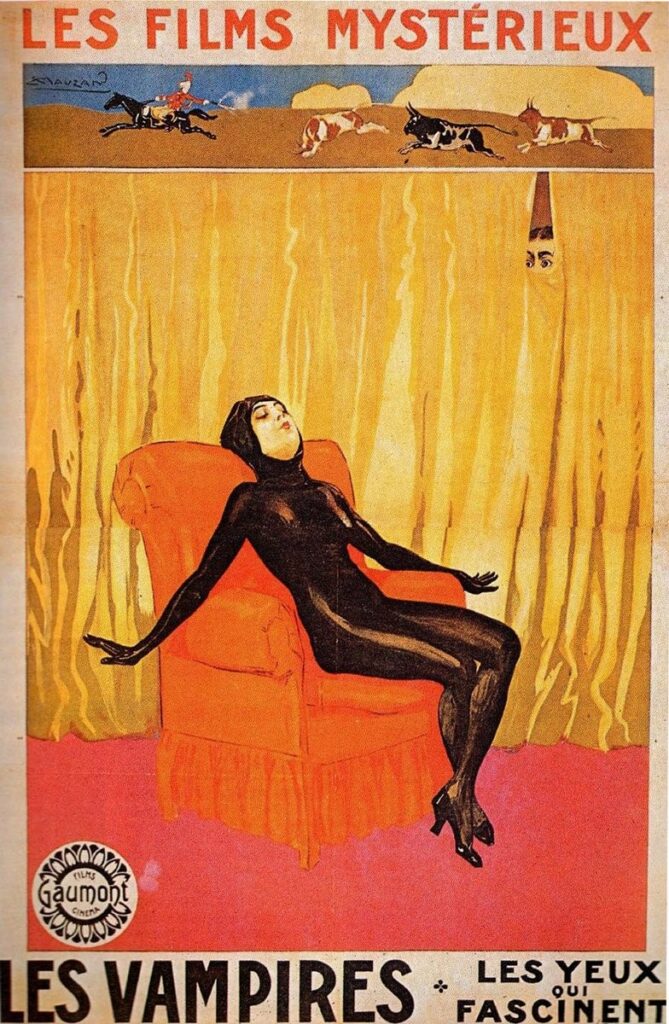
Darum geht’s: Der Journalist Philippe (Édouard Mathé) hat ein Lebensprojekt: Das Geheimnis der Verbrecherbande namens Les Vampires entschlüsseln und die Schurken endlich hinter Gitter bringen. Gemeinsam mit seinem Freund Mazematte (Marcel Lévesque) verfolgt er die Bande über die Dächer von Paris. Doch Les Vampires – allen voran Irma Vep (Musidora) – nutzen alle Finessen der modernen Technik und scheinen ihm immer einen Schritt voraus zu sein.
Achtung: Schwere Spoiler!
A: Endlich haben wir Les Vampires gesehen. Ein wenig inspiriert von Out 1 – noli me tangere (Rivette 1971/1990).
J: Und irgendwie passt das gut, weil es bei Les Vampires auch um einen Geheimverbund geht, auch wenn es hier eindeutig eine verbrecherische Organisation ist.
A: Trotzdem gibt es Elemente, die zeigen, dass der Geist von Les Vampires noch irgendwie in Out 1 reinschimmert, so als französische Kontinuität. Die Idee der Ermittlung zum Beispiel, dass man Codes knacken muss, wie dieses Kryptogramm.
J: Obwohl dieser Journalist Phillipe eigentlich gar nicht so ein guter Ermittler ist. Erfolgreicher ist dieser Mazamette, der eine super Intuition dafür hat, wo man gucken, wo man lauschen und wem man folgen muss.
A: Ja, er kennt sich einfach super gut in diesem Pariser Viertel aus und beobachtet sehr genau. In einer Szene steht er einfach am Fenster, sieht Leute in eine Scheune gehen und merkt gleich, dass da etwas komisch ist. Anderen wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Dabei ist er aber auch einfach so eine Happy-go-lucky-Figur.
J: Ja, so ein bisschen schon. Er ist relativ unbedarft und schaut offen in die Welt.
A: Er ist also mehr so, wie man sich einen Reichen vielleicht in einem Chaplin-Film vorstellen würde, als so eine leicht lustige, aber auch etwas melancholische Figur, die gar nicht weiß, was sie mit dem Reichtum anfangen soll.
J: Und Philipp ist dagegen immer sehr zielgerichtet. Er hat ein bestimmtes Projekt, was ihn für viele Sachen ziemlich blind macht.
A: Bei den Gangstern ist es genauso. Die sind immer in irgendwelchen Plänen verfangen, sehen aber oft nicht, was nebenan im Raum passiert. Dadurch scheitern sie ja auch oft an ihren ausgefeilten Plänen, die wirklich genial sind. Allein was sie alles unternehmen, um irgendwie Leute zu entführen, mit so ganz komplizierten Fallen und Fangnetzen, ein riesiger Aufwand, um etwas relativ Simples zu erreichen. Aber ihre Pläne werden immer durch so eine Unschuldigkeit des Guten letztlich vereitelt.
J: Obwohl die Guten gar nicht viel machen. Philippe ist so starr, dass seine einzige Kraft eigentlich darin liegt, dass er sehr konform ist.
A: Er ist wirklich mega konform. Er wohnt bei seiner Mutter, und er scheint auch seine Ehe einfach nur einzugehen, weil es irgendwie Sinn macht. Man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwas Persönliches dabei ist. Und seine Freundschaft zu Mazematte, die basiert auch mehr auf Nützlichkeit, weil er ihm dauernd hilft.
J: Das ist etwas, was die Vampire bis zum Schluss nicht verstehen, dass eigentlich nicht Philippe die Gefahr ist, sondern Mazematte. Er durchkreuzt ihre Pläne und lässt sie immer wieder verhaften. Philippe schreibt eigentlich nur hinterher darüber.
A: Die Vampire sehen Bedrohungen immer nur im Außen, obwohl die sich oft selbst im Weg stehen. Dieses Bandensystem wird hier auch ein bisschen humorvoll aufbereitet.
J: Sie betreiben sehr viel Aufwand, vor allem wenn man das Risiko, dass sie eingehen gegen das Geld rechnet, das sie da rausziehen. Das ist total unverhältnismäßig, eigentlich verrückt. Für die meisten Vampire geht das ja auch gar nicht gut aus. Nur Irma Vep ist so eine Konstante bei den Vampiren. Diese wechselnden Grand Vampires sind ihr gegenüber ziemlich blass.
A: Das ist trotzdem eine total spannende Struktur, wie diese Gangs da funktionieren. Das gibt es ja so ähnlich auch bei Fantômas (Feuillade 1913) oder Mabuse, der Spieler (Lang 1922). Doch da ist es immer so leicht okkult angehaucht. Bei den Vampiren hingegen ist es halt mehr so eine okkulte Organisationsstruktur, also dass du halt wie bei den Köpfe der Hydra immer einen abschneiden kannst und es kommt immer wieder irgendwer nach.
J: Einmal gab es aber diese Geschichte mit der Hypnose.
A: Das macht ja dieser Moreno, der eigentlich gar nicht zu den Vampiren gehört, der nur so zwangseingegliedert wird, weil die ihn erpressen. Die Vampire an sich machen eigentlich gar nicht wirklich etwas Spiritistisches.
J: Sie setzten mehr auf moderne Technik. Sie haben sogar einen Raketenwerfer. Da wird dann auch der Erste Weltkrieg sichtbar, der sonst höchstens im Hintergrund mitschwingt.
A: Und sie haben diese ausgeklügelten Techniken, um Leute aus Fenstern zu ziehen. Du stehst da am Fenster und plötzlich legt sich irgendeine Schlinge um deinen Hals oder irgendein Haken und dann wirst du da einfach runtergezogen und aufgefangen und mitgenommen. Das ist immer total überraschend, auch wenn es schon ein paar Mal passiert ist.
J: Trotzdem ist es erstaunlich einfach, in die Häuser der Vampire einzubrechen. Der Humor kommt eben auch aus dem Wechsel zwischen den total ausgefeilten Plänen und den Momenten totaler Unbedarftheit.
A: Genau, alle agieren so hands-on und die Oberschurken sind dann auch immer noch persönlich in einer Kiste oder so versteckt, um zu spionieren. Sie erledigen also Dinge, von denen man denken würde, dass sie dafür Handlanger haben.
J: Vor allem Irma Vep muss immer selbst erscheinen, weil sie für diese Verbindung performativ so wichtig ist. Die tritt ja auch immer in diesem Theater auf und animiert die Leute.
A: So ein bisschen wie in Metropolis (Lang 1927), wo die Maria da rumläuft und alle sich vor Geilheit quasi in so einen verbrecherischen Wahnsinn reinsteigern.
J: Und ihr Name ist ein Anagramm für die Vampire.
A: Das ist immer so eine Frage, inwieweit diese Vampire so eine Art von Idee sind, die unabhängig von bestimmten Personen weiter bestehen kann, wie so eine Terrororganisation.
J: Aber die Vampire folgen nicht so richtig einer bestimmten Idee, außer Geld zu stehlen.
A: Ich habe sogar das Gefühl, dass sie eigentlich gar nichts damit verdienen. Das scheint vielleicht wirklich eher so der Wunsch nach Zerstörung zu sein. Trotzdem unterscheiden sich die Vampire von Terroristen, da sie keine Botschaft damit verbinden.
J: Das ist einfach so Disruption um der Disruption willen.
A: Das kann man auch im Zusammenhang mit der Zeit sehen. Da sind diese großen Umbrüche, die Aristokratie liegt in ihren letzten Zügen und macht Platz für das Bürgertum und die Massenkultur. Und gleichzeitig spielt es mitten im Ersten Weltkrieg. Die Megadisruption ist im Gange und es entsteht so eine Angst, dass alles in sich zusammenbricht.
J: Dennoch ist der Erste Weltkrieg hier ziemlich unsichtbar. Klar, man hat einmal diesen Raketenwerfer, diese Artillerie, was damals so die modernsten Waffen waren. Aber die Figuren reden nie über den Krieg, selbst Philippe als Journalist scheint das Kriegsgeschehen überhaupt nicht zu beschäftigen.
A: Aber man kann das trotzdem alles ganz gut als Stand-In für den Krieg verstehen.
J: Ja, vielleicht.
A: Ich meine, dass sie mit Raketen ein Schiff versenken, ist ja schon bemerkenswert. Hätte man jetzt in Paris nicht unbedingt gedacht, dass da so eine Szene entsteht. Und die Marine war ja im Ersten Weltkrieg auch ziemlich wichtig.
J: Im Hintergrund schwingt das mit. Trotzdem wird der Krieg ziemlich auffällig nicht erwähnt. Das kann auch so eine Form von Eskapismus sein, also dass man diese Ängste alle in so ein comic-artiges Spiel umdeutet.
A: Also Mabuse wird ja auch gerne so gelesen, dass diese großen Demagogen schon vorhergesehen wurden, die dann nach dem Ersten Weltkrieg in der Politik auftreten.
J: Stimmt, dazu gehört auch die Szene mit dem Giftmischer. Der Erste Weltkrieg war ja auch der erste Krieg, in dem Giftgas in größerem Umfang eingesetzt wurde. Die Angst vor diesen Massenvernichtungswaffen scheint der Film schon aufzunehmen, in der Szene, wo die Vampire eine ganze Festgesellschaft durch ein Gas betäuben. Sie sind dabei sogar mit Gasmasken unterwegs. Trotzdem hat man das Gefühl, dass es in dieser Welt den Krieg eigentlich nicht wirklich gibt. Doch manche Szenen sucht er dann in so einer verdrehten Weise heim.
A: Trotzdem ist es eine Welt im Umbruch. Und ich finde es interessant, dass die, die hier für den Umbruch stehen oder für das Chaos, so schillernde Figuren sind, die einen in dieser Serie interessieren. Also dieser Philipp, der kann einen ja kaum interessieren. Ich glaube auch kaum, dass er damals interessiert hat. Aber die anderen, Irma Vep und Moreno und auch dieser Giftgas-Experte, das sind eher die Charaktere, auf denen sich die Faszination eigentlich aufbaut.
J: Ja, die Irma Vep, das ist dabei eigentlich so die schillerndste Figur.
A: Das ist ja auch die Kultfigur, die sich aus dieser Serie weiterentwickelt hat. Sie ist es auch, auf die in Out 1 angespielt wird. Sie ist auf jeden Fall die Fantomas- oder Mabuse-Figur dieser Serie. Im Vergleich zu aktuellen Serien fand ich es übrigens auch total erfrischend und schön, wie viele krasse Entscheidungen die Serie von Folge zu Folge trifft.
J: Ja, es ist ein anderes Erzählprinzip, weil man halt gar nicht davon ausgeht, dass Leute das alles sehen. Jede Folge steht auch für sich. Das ist anders als bei heutigen Serien, die meist für ihre Cliffhanger bekannt sind, wo die Folgen oft mit einem ganz großen Schlag enden, wo alles zwischen Leben und Tod hängt. Und in der nächsten Folge musst du dann rausfinden, wie die Helden da wieder rauskommen.
A: Ich habe gelesen, dass, weil die anderen Serials von Gaumont so erfolgreich waren, viele auf den Zug aufgesprungen sind und viele Serials dann komplett ohne Drehbuch entstanden sind. Also die haben einfach angefangen zu drehen und während des Drehens das Ganze geschrieben. So kommen möglicherweise auch einige dieser irren Wendungen zustande: “Ach, jetzt ist der Bösewicht tot. Wie machen wir jetzt weiter? Dann gibt es halt noch einen.” Da wird dann einfach relativ rücksichtslos immer nach vorne geschrieben. Das ist irgendwie sehr befreiend. Das befreit einen beim Gucken auch so gegenüber diesen Serien, wo man dann so denkt: „Ach, da hat sich jemand hingesetzt und das lange ausgeplant, aber er bemüht sich die ganze Staffel lang, mir nichts davon zu verraten, was geplant ist.
J: Und wenn man das heute sieht, mit einem Abstand von über 100 Jahren, sind auch einfach viele Details total interessant, die die Menschen damals vermutlich nicht so spannend fanden, zum Beispiel der Umgang mit Visitenkarten. Das habe ich noch nie gesehen. Also erstmal sind die Visitenkarten erstaunlich leer, da steht immer nur ganz klein der Name drauf. Und diese Visitenkarten werden dann von dem Diener oder der Dienerin auf ein Tablett gelegt und zu dem Hausherrn und der Hausherrin gebracht. Danach erst können die Gäste eintreten. Das ist ein Ritual, das immer wieder in diesem Serial auftaucht.
A: Ja, was ich ganz früh in der Serie schon hatte, ist irgendwie dieses Gefühl, dass Altes und Neues aufeinandertrifft. Du hast ja auch Leute, die fahren in Autos durch die Gegend und in der nächsten Szene fahren sie in einer Kutsche. Immer alles zeitgleich. Reiche Leute haben sogar schon Telefone, wobei es in ganz Paris wahrscheinlich nur 10 Nummern gibt, die man anrufen kann. Das sieht man ja auch in Filmen aus dem Zeitalter so gut wie nie. Gleichzeitig läuft aber noch ganz viel Kommunikation über Briefe und über Codes in Briefen, die man dekodieren muss.
J: Ganz viel wird auch noch handschriftlich gemacht. Nur einer hat eine Schreibmaschine.
A: Genau, alles handschriftlich. Das wirkt aus heutiger Perspektive auch so unwirklich, wie die Vampire einfach mit einer gefälschten Unterschrift einen Scheck einlösen können. Man schreibt es einfach auf ein Papier: “Ich möchte gerne so und so viel Geld abheben”, eine Unterschrift drunter und das war es dann. Die Unterschrift sieht ähnlich aus und dann werden 20.000 Francs einfach so rausgegeben. Das ist total absurd teilweise. Und das mit diesen Visitenkarten, das ist noch so ein Nachwehen der Aristokratie. Früher hattest du einen Herold, der kam und angesagt hat, wer gerade kommt. Jetzt haben sie nur noch Karten, die sie auf Tabletts legen, um sich gegenseitig zu sagen, dass sie kommen und wer sie sind.
J: Das sickert dann so in die Mittelschicht durch. Philippe gehört nicht zur Aristokratie, aber kopiert diese Formen.
A: Ja, das Aristokratische verschwimmt auch schon so mit der Business-Welt.
J: Genau, man hat auch diese reichen amerikanischen Geschäftsmänner, deren ankommen in Paris immer durch die Zeitungen angekündigt wird. Diese Art der Ankündigung – also einfach nur, welcher reiche Mensch nach Paris kommt und in welchem Hotel er übernachtet – fand ich auch sehr merkwürdig.
A: Super ist auch die Szene, wo die Vampire von dem amerikanischen Geschäftsmann die Stimme stehlen wollen, indem sie unter einem Vorwand eine Tonaufnahme mit so einem Wachszylinder machen. Der Geschäftsmann ist selbst total fasziniert von dieser neuen Technik und merkt überhaupt nicht, dass er betrogen wird. Das war ja noch gar nicht lange her, dass die ersten Tonaufnahmen gemacht wurden. Daran merkt man ganz gut, wie krass das für die Leute gewesen sein muss, am Anfang des 20. Jahrhunderts, diese technologischen Sprünge zu vollziehen.
J: Ja, man spürt aber auch, dass die neue Technik die Menschen verunsichert. In dem Serial wird die Technik schon für viel Böses eingesetzt. Einmal manipulieren die Vampire ja auch diese Telefonanlage und setzen dann den vom Geschäftsmann besprochenen Wachszylinder davor, so dass es wirkt, als würde er selbst am Telefon antworten.
A: So ein bisschen retrospektiv hat man das auch in Das Lächeln einer Sommernacht (Bergman 1955), der in einer ähnlichen Zeit spielt, wo es diese ganze Technik, Psychotechnik und Spiritismus gibt, die in der Logik der Erzählung alle gleich wahrscheinlich wirken. Hier kann Moreno einfach Leute hypnotisieren und macht das auch mit der Haushälterin. Das scheint nicht viel abwegiger zu sein als ein Telefon oder dieser Wachszylinder, der durch das Hoteltelefon gespenstische Töne schickt.
J: Auf der anderen Seite ist es dann aber auch interessant, wie der Mazematte alles total untechnisiert durch die bloße Sinneswahrnehmung löst. Er benutzt nur seine Ohren und Augen und schlägt damit die Gangster mit ihrer ganzen ausgefeilten Technik.
A: Also der Mensch mit seinen ganzen neuen Prothesen auf der einen Seite, das sind die super medialen Gangster, und dann auf der anderen Seite die bodenständigen, anständigen Leute, die irgendwie noch dagegen halten können, mit ihrem Körper.
J: Vielleicht wirkt Philippe auch aufgrund dieser Gegenüberstellung so inkompetent, weil der Journalismus selbst in diese Spannung nicht so recht hineinpasst. Der Journalismus – der ja selbst mit den neuen Techniken umgehen lernen muss – wird überhaupt nicht als eine Größe präsentiert, die irgendwie gegen die technikaffinen und gut vernetzten Gangster ankommt. Wenn überhaupt, dann sabotiert die Journalisten eher das Gute, indem sie alles, was sie wissen, öffentlich ausposaunen. Philippe und seine Kollegen gehen total unbedacht mit Informationen um und bringen dadurch Leute in Gefahr.
A: Das wird als so ein Sensationsjournalismus gezeigt, der für alles durchlässig ist. Beide Seiten, das Gute und das Böse, nutzen den Journalismus, um sich durch die Stadt zu navigieren. Einen Sensationsjournalismus allerdings, mit dem bidersten Journalisten, den man sich vorstellen kann.