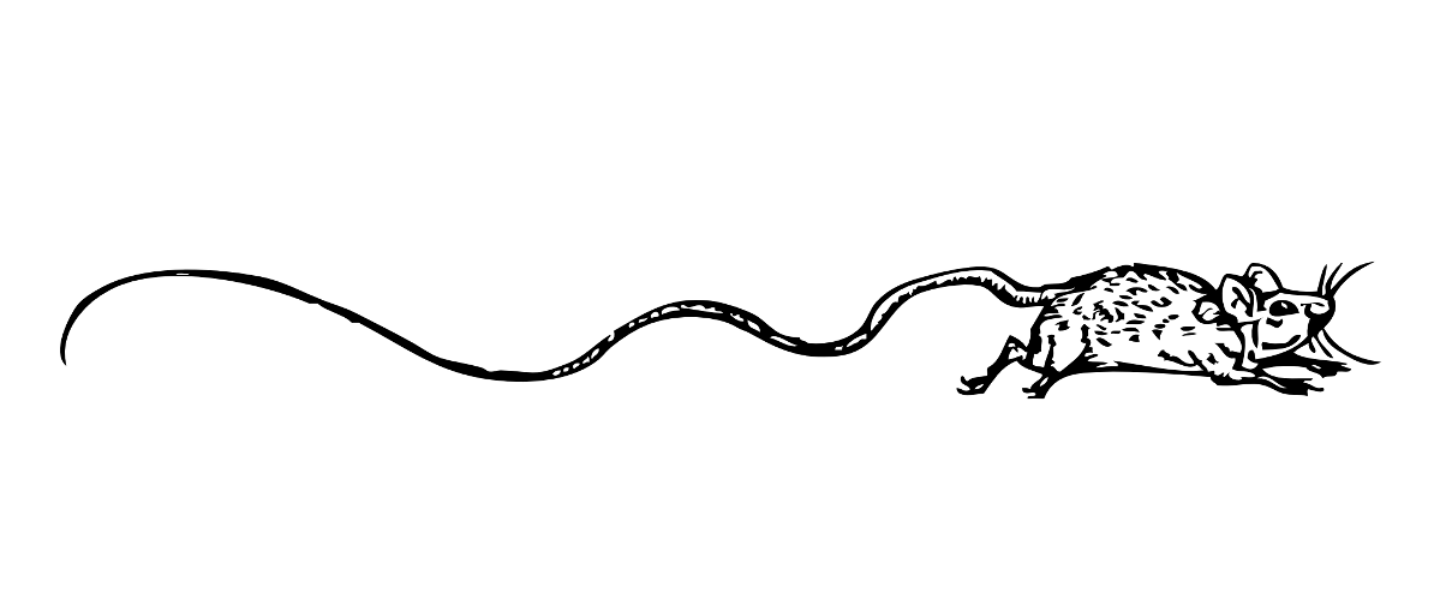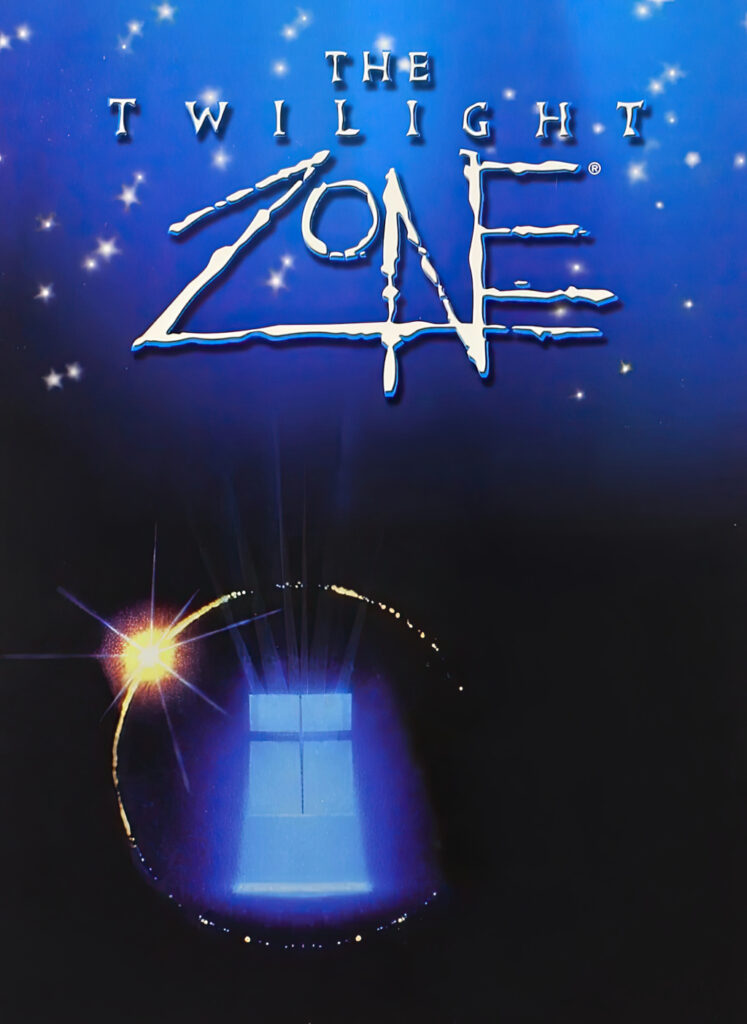
Darum geht’s: Bill Lowery steht vor einer Herausforderung: Sein Unternehmen bringt eine neue Produktlinie auf den Markt und er muss sich rasch in die unbekannte Materie einlesen. Doch pötzlich sind ihm nicht nur die Dokumente auf seinem Schreibtisch unverständlich, sondern die Menschen um ihn herum beginnen seltsam zu reden. Innerhalb weniger Tage sieht er sich mit einer vollkommen anderen Sprache konfrontiert. Ausgerechnet als er der Außenwelt vollkommen entfremdet wird, erkrankt sein Sohn an einem schweren Fieber.
Achtung: Schwere Spoiler!
J: Womit fängt man hier an? Gar nicht so einfach.
A: Man könnte dort anfangen, wo die Folge richtig abhebt. Also dort, wo die Sprache entgleitet. Darin ist der Plot ja sehr allegorisch: Das kann tatsächlich auch eine Krankheit sein. Ein grober Begriff dafür wäre Aphasia. Da müsstest du wieder das Griechische erklären.
J: Klar doch: ‘a’ ist ‘nicht’ und ‘phasia’ leitet sich ab von dem Verb ‘sagen’. Man kann etwas nicht sagen.
A: Also sehr allgemein. Aber ich glaube, das wird größtenteils für Schlaganfallpatienten benutzt, die dann Schwierigkeiten haben, die Sprache noch zuzuordnen.
J: Die Sache ist ja, dass im Gehirn die Wörter, also die einfache Lautfolge der Wörter, und die Bedeutung der Wörter in verschiedenen Hirnarealen gespeichert werden. Und wenn man einen Schlaganfall hat, kann es sein, dass beide Schaden genommen haben, oder halt auch nur eines, so dass man vielleicht noch die Wörter bilden kann, aber ihre Bedeutung nicht mehr versteht. Oder umgekehrt kann es passieren, dass man die Bedeutung von Wörtern noch versteht, aber keine Wörter mehr bilden kann. Je nachdem, wo der Schlaganfall einen getroffen hat, kann sich das in verschiedenen Sprachstörungen manifestieren.
A: Und das ist eigentlich sehr anders als das, was in dieser Folge stattfindet. Hier hat das Ganze ja scheinbar weiterhin eine Systematik. Die Wörter sind grammatikalisch immer noch genauso verbunden. Nomen sind immer noch Nomen, nur die Wörter werden ausgetauscht. Der Protagonist heißt beispielsweise eigentlich ‘Bill Lowery’, und irgendwann findet er heraus, dass sein Name in dieser neuen Sprachwelt nun ‘Hinge Thunder’ ist. Oder sein Autogurt heißt jetzt ‘stepdad’. Wo bei seinem Auto vorher ‘fasten seatbelt’ stand, ist nun ‘fasten stepdad’ zu lesen. Die Wörter sind vertauscht, aber sie haben anscheinend noch dieselbe Funktion.
J: Ja, das ist echt krass. Da ändert sich überhaupt nichts an der grammatikalischen Struktur der Sprache, obwohl man sich da ja auch vieles vorstellen könnte. Es hätte ja sein können, dass man die Sätze anders zusammenbaut, z.B. das Verb nach hinten nimmt, oder dass man mehr Fälle hat als vier – unsere Sprache hatte ja früher auch mal acht Fälle. Aber da ändert sich tatsächlich gar nichts, die Struktur der Sprache, die Grammatikregeln bleiben exakt gleich.
A: Das wäre ja auch noch unheimlicher. Nicht, dass das jetzt nicht auch schon unheimlich genug wäre, aber immerhin gibt es diese Option, dass man praktisch wieder sprechen lernt. Man muss dafür den gesamten Wortschatz neu mit den Dingen verknüpfen. Das ist wahrscheinlich unglaublich verwirrend in den ersten paar Jahren.
J: Ich glaube, es ist einfacher, eine völlig neue Sprache zu lernen, mit einer anderen Grammatik und einem völlig neuen Wortschatz – einfacher, als sich so umzugewöhnen. Denn die Dinge sind ja in deinem Kopf gespeichert, gerade deine eigene Muttersprache ist ja sehr tief verankert. Und dann dir anzugewöhnen, für jedes Wort eine neue Bedeutung zu lernen, das ist wahrscheinlich…
A: …ziemlich hart. Glaube ich auch.
J: Gut, der Vorteil ist natürlich, dass die Grammatik bestehen bleibt.
A: Ja, und du kannst eben zumindest dann nach einer gewissen Zeit die Menschen wieder verstehen. Das ist, glaube ich, auch anders als bei dem Krankheitsbild der Aphasia. Irgendwann weißt du halt, dass das Wort ‘Hund’ nun ‘Mittwoch’ heißt, und wenn der Nachbar dir dann andauernd von seinem Mittwoch erzählt, dann weißt du, dass er seinen Hund meint.
J: Genau. Da scheint ja auch kein Problem im Gehirn zu sein. Bei einem Schlaganfall werden ja auch wirklich Nervenzellen zerstört, das ist hier nicht das Problem.
A: Nee, wahrscheinlich nicht.
J: Das wird jedenfalls nicht nahegelegt. Die Ursache wird überhaupt nicht angedeutet.
A: Ja, es scheint einfach so passiert zu sein.
J: Was ich aber noch interessant finde – diese Wörter zu vertauschen, das wirkt halt wirklich fast wie etwas, was man absichtlich tun würde. Das hat mich so ein bisschen an diese Kurzgeschichte Ein Tisch ist ein Tisch (D, 1969) von Peter Bichsel erinnert. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aus der Schule vielleicht?
A: Haben wir nicht gelesen.
J: Da geht es um einen alten Mann, der sehr routiniert lebt, der ein bisschen einsam und gelangweilt ist. Und der einfach möchte, dass sich irgendwas ändert und dann eines Tages aus Spaß anfängt, Gegenstände in seinem Zimmer umzubenennen. Also für den Tisch ‘Bett’ sagt, für das Bett ‘Stuhl’ – er hat halt alle möglichen Gegenstände, und da vertauscht er einfach die Wörter. Das dehnt er dann immer weiter aus. Erst sind es nur ein paar Nomen, dann werden es immer mehr Nomen, dann kommen irgendwann Verben dazu. Das wird eine richtige Obsession. Irgendwann kommt es dazu, dass er seine Nachbarn immer weniger versteht, also dass sich in seiner Erinnerung die neuen Bedeutungen vor die alten schieben. Am Ende kann er mit seinen Nachbarn nicht mehr kommunizieren. Und das endet eher traurig, er ist am Ende einsamer als vorher. Er verschlimmert alles dadurch, dass er im Prinzip eine Art Privatsprache erfindet. Und da ist das als ein absichtlicher Prozess dargestellt, obwohl es hinterher denselben Effekt hat wie in dieser Twilight Zone-Folge, nämlich dass er die Leute nicht mehr verstehen kann. Das finde ich interessant, weil die Folge ja auch Wordplay (Craven, USA 1985, S1.E2) heißt. Aber da ist das gar kein Spiel, sondern eher etwas, das ihm einfach passiert, das von außen kommt.
A: Richtig, die Folge macht das eigentlich gar nicht, was der Titel suggerieren würde, dass es sich um ein ‘play on words’ handeln könnte.
J: Und sie hat am Ende noch so eine positive Wendung, da er tatsächlich versucht, die Sprache zu lernen, die ihm aufgezwungen wurde. Bei Bichsel hingegen findet der alte Mann keinen Ausweg aus der Verwirrung, sondern bleibt in der Privatsprache stecken.
A: Ja, das passt schon total gut. Das ist einfach so ein bisschen invertiert. Bei beiden Situationen ist es aber halt so, dass die Sprache wirklich als Zugang zur Welt verstanden wird, und wenn man darauf keinen Zugriff mehr hat, dann ist die Welt einem auch nicht mehr verständlich.
J: Aber gleichzeitig wird auch die völlige Konventionalität der Sprache betont. Es gibt ja seit der Antike die Diskussion in der Linguistik, ob es eine natürliche Verbindung zwischen Wort und Zeichen gibt, oder ob die Verbindung zwischen Zeichen und Bezeichneten nur auf einer Übereinkunft beruht. Und beide – Wordplay wie auch Ein Tisch ist ein Tisch – machen deutlich, dass es auf einer reinen Übereinkunft beruht. Es spricht ja eigentlich nichts dagegen, dein Mittagessen „Dinosaurier“ zu nennen. Wenn alle das machen, dann kann man sich auch so verständigen.
A: Ja, er findet sich praktisch in einer alternativen Dimension wieder oder in einem Spiegeluniversum, wo er die Übereinkünfte nicht kennt. Unheimlich ist das nur, weil es seine eigene Welt und sein verinnerlichter Sprach- und Kulturkreis ist.
J: Was ich aber auch interessant finde, ist die Reaktion der anderen Leute. Die reagieren ja überraschend gelassen. Man würde doch erwarten, dass seine Frau, seine Arbeitskollegen sich mehr Sorgen machen, oder vielleicht wirklich denken, er sei krank, hätte einen Schlaganfall. Die Situation muss für sie ja auch komisch sein, da aus deren Sicht wahrscheinlich er derjenige ist, der merkwürdig spricht. Als Zuschauer sieht man das nur aus seiner Perspektive.
A: Es gibt ein paar Konfrontationen: Einmal sagt er seiner Sekretärin, sie soll die Anrufe nicht mehr weiterleiten und dann ist sie völlig verwirrt, als hätte er irgendwas Obzönes gesagt. Es gibt dann schon Fälle, wo Leute irritiert sind, aber das wird nicht weiter ausgespielt. Ich glaube, da schlägt die kurze Laufzeit dieser Story von lediglich 18 Minuten zu Buche. Da sind so viele Momente, wo man sich denkt: „Oh, das wäre jetzt interessant, wenn man das weiterdenken würde, was passieren würde in dieser Situation.“ Stattdessen verbleibt man größteteils bei der zentralen Beziehung zwischen ihm und seiner Frau. Und da ist es so, dass sie über diese Krise mit dem Sohn notgedrungen eine wortlose Kommunikation aufbauen, ohne dass das von ihr noch groß hinterfragt wird. Man hat eben nicht diesen Moment, wo sie quasi völlig zusammenbricht, weil sie merkt, dass ihr Mann nur noch Blödsinn erzählt und sie ihn eigentlich zum Arzt schicken müsste. Irgendwie scheint sie zu merken, dass ihm in dieser Hinsicht nichts fehlt, dass er eben keine Aphasie hat.
J: Interessant ist ja auch, dass sich die Zeichensprache, also Körpersprache und Mimik, nicht mitändert. Es ist wirklich auf die Wortsprache beschränkt. Die non-verbale Kommunikation, die tatsächlich einen großen Teil menschlicher Kommunikation ausmacht, bleibt völlig gleich. Vielleicht könnte man mutmaßen, dass die Körpersprache weniger konventionell ist, obwohl ich glaube, dass die Kulturwissenschaft sagt, dass diese zum großen Teil auch kulturgebunden ist und es höchstens ein paar Konstanten gibt, die wirklich durch die Biologie festgelegt sind. Dass man winkt, wenn man jemanden begrüßt, ist ja auch reine Konvention. Selbst beim Lächeln gibt es kulturelle Unterschiede. Das scheint ja alles relativ gleich zu bleiben, da entstehen keine Irritationen.
A: Und das ist auch das, was dann letztendlich Hoffnung gibt, also sowohl ihm als auch der Zuschauerin, dem Zuschauer, dass im Grunde Sprache – also verbale Sprache als die konventionalisierten Zeichen – nur ein Kanal unter vielen ist, durch die man sich als Mensch medial austauscht. Und er und seine Frau finden halt zum Beispiel über Mimik und Gestik, und einfach über dieses vertraute Gefühl untereinander zu einer Kommunikation, wo sie diese Art der Sprache, diese verbale Sprache, gar nicht mehr brauchen.
J: Depression und Hoffnung liegen da nah zusammen.
A: Ja, und ich finde, das spielt Robert Klein richtig gut. Er war ja eigentlich Stand-Up-Komiker und Sänger, war Host bei Saturday Night Live und hat Comedy-Specials herausgebracht. Und wenn man sich seine Auftritte anguckt, dann ist er dabei körperlich total expressiv, und das ist ja in seiner Performance in dieser Folge völlig weg. Man kann das an seinem stillgelegten Gesicht sehr schön ablesen, wie sich da langsam aber sicher der blanke Terror einschleicht. Gegen Ende weicht das wieder einer leisen Hoffnung auf Normalität.
J: Er gibt sich wirklich Mühe, einen ‘Jedermann’ zu spielen. Auch das ganze Setting ist ja so, vom Haus bis zur Familie und zum Arbeitsplatz, und es gibt auch kein Bestreben eines Ausbruches. Das ist nicht diese typische Midlife Crisis-Erzählung: Die Krise als Gelegenheit, dieses Leben hinter sich zu lassen. Vielmehr ist das gewöhnliche Leben schon genau das, was er anstrebt und wiederhaben will. In diesem ‘Normal’ wird das Utopische oder auch das Glück gesehen.
A: Und das ist ja auch wieder so ein Thema, das in der ersten Twilight Zone-Serie andauernd vorkommt, z.B. in der Folge Walking Distance (Stevens, USA 1959, S1.E5), wo der Mann in der Nähe seiner alten Heimatstadt auf einer Geschäftsreise durchkommt, plötzlich in der Zeit zurückreist und sich selbst und seine Eltern trifft. Oder auch A Stop at Willoughby (Parrish, USA 1960, S1.E30), die Folge mit diesem Menschen, der aus Mad Men (USA, 2007-2015) zu flüchten scheint.
J: Ja, der Mann, der mit dem Zug fährt und in dieser hübschen, idyllischen Kleinstadt aussteigen will.
A: Genau, mit diesem Werbefachmann, der völlig auf dem Zahnfleisch geht und einfach nur raus will aus seinem Job, aber es gibt keinen Ausweg, und seine Frau hilft ihm auch nicht. Und immer wenn er mit dem Zug fährt, hält dieser, wenn er eingeschlafen ist, in einer Stadt im 19. Jahrhundert.
J: Ein Kaff, wo man noch das gewöhnliche, unspektakuläre Leben suchen kann. Er ist halt hoch auf der Karriereleiter, träumt aber von dem ganz einfachen Leben in der kleinen Stadt.
A: Auch diese Folge endet trotz des düsteren Twists aber irgendwie auf einer dezent hoffnungsvollen Note. Dabei ist die originale Serie für ihre bitteren Ausgänge bekannt. Aber nicht jede Folge ist wie Time Enough at Last (Brahm, USA 1959, S1.E8), wo alles vor die Hunde geht und die Welt in Scherben liegt. Es gibt auch viele Geschichten, wo sich einfach die Realität verändert, und dann muss man damit irgendwie klarkommen. Und da hat man auch schon mal Enden, die offen bleiben, aber nicht unbedingt nur negativ besetzt sind. Und das sehe ich in Wordplay auch.
J: Auf jeden Fall.
A: A World of Difference (Post, USA 1969, S1.E23) fand ich auch spannend, wo dieser Geschäftsmann in San Francisco in den Urlaub fahren will, alles vorbereitet und dann feststellt, dass sein Telefonanschluss nicht funktioniert. Er will sich beschweren und jemand ruft „cut!“. An dem Punkt stellt er fest, dass er auf einem Filmset ist und eigentlich Schauspieler. Der Geschäftsmann ist nur seine Rolle. Das war auch so ein Fall, wo sich einfach die Realität schlagartig verändert – in diesem Fall viel schneller als in Wordplay, quasi mit einem Schnipsen. Das ist eine ähnliche Art von Folge, die jetzt nicht durch irgendwelche Twists im Laufe der Handlung motiviert ist, sondern einfach dadurch, dass man diese veränderte Situation hat und das bewältigen muss.
J: Und er selbst ist auch ein ganz anderer. Er hat einen anderen Beruf, eine andere Frau. Diese plötzliche Änderung der Lebenswelt hatte man doch auch in dieser Folge mit dem Schutzengel, der so einem sympathischen Träumer helfen will, sein ganzes Leben ummodelliert und ihn zu einem erfolgreichen Anzugträger umbaut.
A: Mr. Bevis (Asher, USA 1960, S1.E33), ja genau! Das ist auch wieder etwas, das von außen kommt und das ganze Leben durcheinanderbringt.
J: Die Atmosphäre um dich herum ist einfach anders, die Leute sind anders zu dir und erwarten was anderes von dir. Und hier bei Wordplay kommt noch die Frage hinzu, auf welcher Realitätsebene sich die Sprache eigentlich befindet. Wenn man einfach nur die Realität der physikalischen Dinge sieht, hat sich gar nichts geändert. Mittagessen ist ja immer noch Mittagessen, auch wenn ich es jetzt „Dinosaurier“ nenne. Und trotzdem hat sich fundamental etwas geändert. Das ist eine interessante ontologische Frage nach dem Status von Sprache, die da mit drin steckt, also, ob sich die ganze Realität irgendwie ändern kann, einfach dadurch, dass die Leute anders sprechen. Er ist ja immer noch der Geschäftsmann, der mit seiner Frau und seinem Kind lebt.
A: Geschäftsmänner scheinen besonders sensibel für die Twilight Zone zu sein. Wobei hier fraglich ist, ob er seinen Job noch lange behalten kann, wenn er die gesamte Art und Weise, verbal zu kommunizieren, neu lernen muss.
J: Das ist vielleicht die Bedrohung, die für ihn noch mitschwingt, dass er seinen Job und dann auch sein Mittelschichtsleben verliert. Das wird nicht angesprochen, aber man kann das dahinter erahnen.
A: In der Schlussnarration wird es immerhin aufgegriffen: „Existence is slippery at the best of times“. Also auch diese Idee, dass das, was wir jetzt serviert bekommen haben, zwar eine sehr außergewöhnliche Veränderung ist, die so im wirklichen Leben wahrscheinlich nicht stattfinden würde, aber dass dieses Gefühl, dass sich die Realität der eigenen Existenz wandelt, schon etwas ist, das viele Menschen teilen – sei es durch ganz handelsübliche Geisteskrankheiten wie eine Depression oder eine Angststörung, oder einfach durch Alltagserlebnisse. Man ist halt sehr auf eine bestimmte Art zu denken geeicht, das Gehirn igelt sich irgendwie ein. Und immer wenn dann irgendetwas kommt und es aus der Reserve lockt, kann es passieren, dass man das Gefühl hat: „Oh, ich verliere so ein bisschen den Draht zu den Dingen um mich herum.“
J: Ja, stimmt. Es ist ja auch ein interessantes psychologisches Phänomen, dass man, wenn man ein Wort immer wieder ganz schnell wiederholt, die Bedeutung des Wortes irgendwo verliert, also dass das Gehirn das Wort irgendwann nicht mehr mit der Bedeutung verknüpft.
A: Das passt ja auch wieder irgendwie gut zu dem Ausgangspunkt der Folge, dass er beruflich so viel mit scheinbaren Nonsens-Wörtern zu tun hat.
J: Ja, genau. Da denkt man vielleicht sogar ein bisschen, dass das die Ursache sein könnte. Auch dieser drohende Jobverlust, der ist ja ohnehin schon da. Er scheint von Anfang an im Job Probleme zu haben, da sich diese neuen Sachen, die neuen Sprachspiele auf seinen Job auswirken. Klar, am Ende verstärkt sich das natürlich noch mal ins Tausendfache, aber im Hintergrund ist von Anfang an diese Idee: „Wenn ich es nicht schaffe, mir den neuen Fachjargon anzueignen, verliere ich meinen Job“. Hinterher geht es dann nicht mehr nur um den Fachjargon, sondern um die Sprache an sich, aber das scheint eher eine graduelle Verschiebung zu sein.
A: Stimmt, dazu passt auch wieder die Schlussnarration:
A question trembles in the silence. Why did this remarkable thing happen to this perfectly ordinary man? It may not matter why the world shifted so drastically for him. Existence is slippery at the best of times. What does matter is that Bill Lowry isn’t ordinary. He’s one of us. A man determined to prevail in the world that was and the world that is or the world that will be, in the Twilight Zone.
Hier hat man auch das Motiv, dass man sich immer wieder anpassen muss, also “to prevail”, dass man die ganzen Veränderugen überdauern will, denen man tagtäglich ausgesetzt ist. Damit sind, denke ich, sowohl die Leistungen des Gehirns gemeint, alles mit Mustern und so weiter zu verknüpfen, wie auch die Leistungen eines Überlebensinstinktes, der einfach darauf trainiert ist, sich jeder noch so verrückten Situation anzupassen. Im Grunde ist das vielleicht fast schon ein Meta-Twilight Zone-Konzept, weil du andauernd diese Episoden hast, wo Leute den unglaublichsten Sachen ausgesetzt sind und trotzdem versuchen, da halbwegs durchzukommen und sich alles zurecht zu rationalisieren, was dann manchmal völlig scheitert. Aber es gibt auch solche Momente, in denen es dann funktioniert. Und dass es funktionieren kann, das fand ich an dieser Folge sehr schön, auch wenn man Twilight Zone als thematisches Ganzes betrachtet. Das macht die Folgen, wo es nicht klappt, für mich auch besser, weil man nicht das Gefühl hat, dass es unweigerlich in den Abgrund führt.
J: Das gibt der Serie auch insgesamt einen optimistischen Ton. Diese doch relativ moderne Feier des normalen Lebens, des normalen Menschen, des Alltagshelden. In der klassischen Mythologie passieren ja solche Sachen, wenn überhaupt, nur großen Helden. Und hier ist es so ein Alltagsheld, der aber doch dieses Merkwürdige meistert.